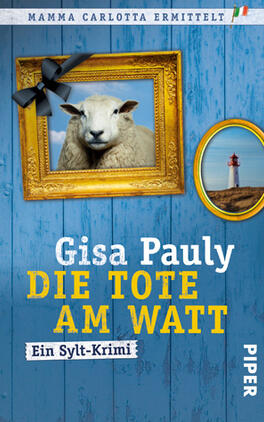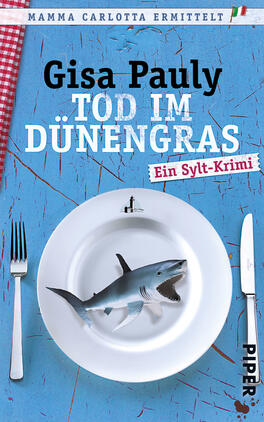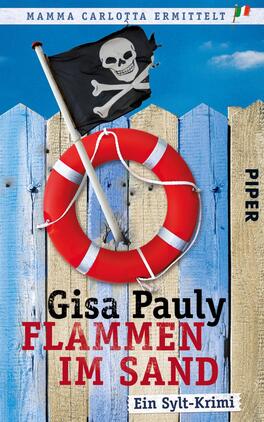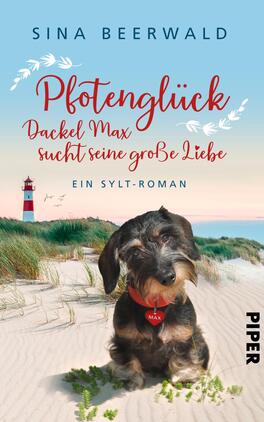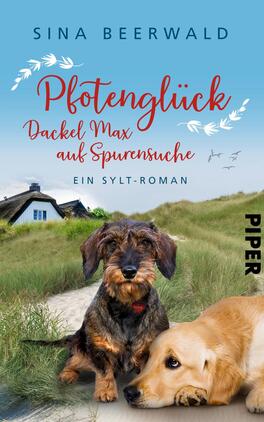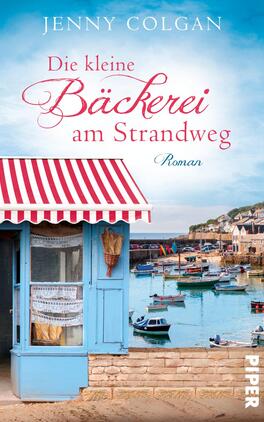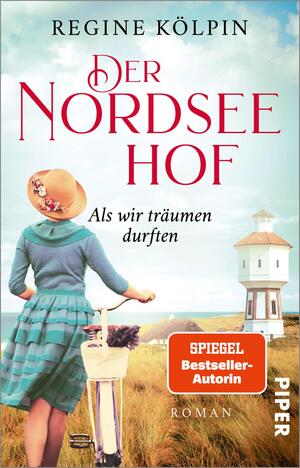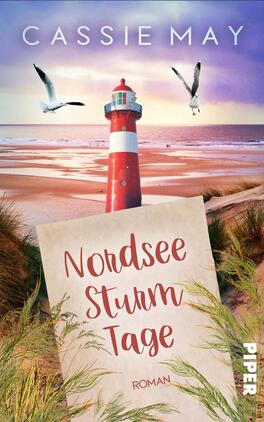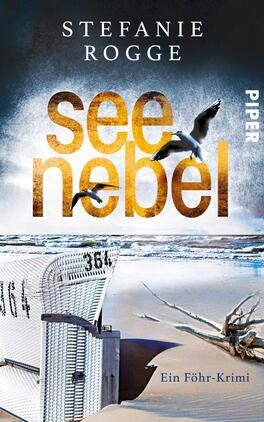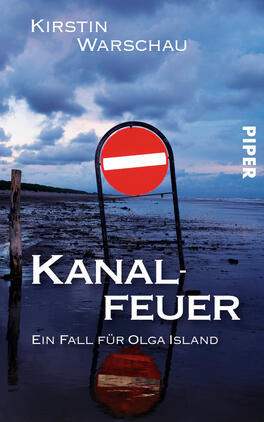Insel- und Küstenromane - romantisch und gefühlvoll
Mit diesen Büchern können Sie sich an die Nord- und Ostsee träumen oder an die Küsten Cornwalls. Gefühlvolle Liebesromane und und spannende Familiensagas warten auf Sie.
Begeben Sie sich auf intensive Reisen an die schönsten Küsten und lassen sich vom einmaligen Charme des Insellebens verzaubern! Losgelöst von der Hast und dem Lärm des Festlands und vom unendlichen Meer umgeben, führen die Insulaner ein eigenes Leben. Ein idealer Schauplatz also für die Entstehung kleiner Bäckereien, dramatische Familiensagen, Freundschaften in Zeiten des Umbruchs, die große Liebe und resolute Hobbyermittlerinnen.
Rauschendes Meer, weicher Sand unter den Füßen und packende Geschichten im Herzen – wir wünschen Ihnen eine wundervolle Zeit mit unseren Büchern!
Der neue Nordsee-Inselroman von Regine Kölpin
„Exakt recherchiert, atmosphärisch dicht und voller Empathie erzählt, mag man das Buch gar nicht zur Seite legen.“ ―
Italienischer Flair auf Sylt
Mamma Carlotta ist eine typische italienische Nonna. Die Familie ist ihr Ein und Alles, ihre Kinder stehen für sie immer im Mittelpunkt. Mamma Carlotta hatte keineswegs ein leichtes Leben. Schon mit sechzehn wurde sie schwanger und bekam in kurzer Folge sieben Kinder. Ihre Schwiegereltern wurden pflegebedürftig und später auch ihr Mann schon in jungen Jahren. Ihr Leben hat immer aus viel Arbeit, Schicksalsschlägen und Entbehrungen bestanden. Trotzdem hat sie es genossen und wollte nie ein anderes. Immer war sie mit dem zufrieden und glücklich, was sie hatte. Eine, wie ich finde, bemerkenswerte Eigenschaft.
Ein liebenswerter Dackel, Sylt und ein Happy End
Romantik mit Meerblick
Eine dramatische Familiensaga vor der stimmungsvollen Kulisse der Nordseeküste
Cosy Crime und Nordsee-Atmosphäre pur
„Die Nordsee ist die Landschaft meiner Seele. Nirgendwo lässt sich besser träumen,...“
Eine Liebesgeschichte wie ein Sommertag am Meer
Spannend, gefühlvoll, idyllisch
Wellen, Meeresbrise und Neuanfang