PROLOG
Sie sagt:
„Ich halte nicht viel von deinen neuen Socken.“
Er sagt:
„Ich halte nie irgendwas von meinen Socken.“
„Auf dem Etikett steht Handwäsche.“
„Und?“
„Ich werde nicht für den Rest meines Lebens deine Socken mit der Hand waschen.“
„Das ist auch unwahrscheinlich. Aber vielleicht für den Rest meines Lebens.“
JUNI
An einem Sonntagmorgen …
An einem Samstagmorgen im vergangenen Sommer saß ich am Küchentisch und sah Dad zu, der unter der heißen französischen Sonne am Ententeich stand und die Bösen Katzen fütterte. Er kam über den Rasen zurück zum Haus, in der einen Hand die leeren Katzenschüsseln, in der anderen, locker schwingend, den zerknautschten Gartenhut. Trotz seines Alters war er lang und schlaksig. Sein Haar hatte noch immer eine elegante Welle, und in den Augen lag das leise Blitzen des ungebärdigen Schuljungen von einst. Ich dachte, wie sehr er Alice ähnelte. Der gleiche schreitende Gang, eckig und englisch, aber nicht unbeholfen. Ein paar weiße Enten folgten ihm watschelnd und stocherten auf der Suche nach Würmern mit den Schnäbeln im Gras. Unter den staubigen Weinranken vor der Hintertür blieb er stehen und zog die Stiefel aus.
Gleichzeitig trat Mum auf der anderen Seite des Hauses durch die Vordertür. Sie trug ein Kleid – sie hätte es als Tageskleid bezeichnet –, das sie, wie ich mich erinnerte, in England gekauft hatte, bevor sie nach Frankreich gezogen waren, also musste es dreißig Jahre alt sein. Es war ein Sommerkleid in knalligen Rosarot- und Blautönen und noch gut in Form, aber ich sah, dass sie die Abnäher auf dem Rücken aufgetrennt hatte. Sie war schon immer eher robust und stämmig gewesen. Untersetzt, im Gegensatz zu Dad. Um sie nachzubauen, hätte man für beide dieselbe Menge Knete gebraucht, allerdings unterschiedlich verteilt. Mum war wie ein wuchtiges viktorianisches Möbelstück: weiche Polster, strapazierfähiger Stoff, Armlehnen aus dunklem Holz und zu schwer, um es allein zu bewegen. Nichts an ihr war schlaff – sie hatte ein rundliches Gesicht und straffe Haut, mit einem leichten Schimmer, wie gutes Eichenholz. Ihre Kleider saßen so eng, als wäre sie in flüssigem Zustand hineingegossen worden.
In der Küche war ich in einer strategisch günstigen Position: Ich konnte sowohl den Vorder- als auch den Hintereingang sehen, blieb selbst aber in der Ecke des L-förmigen Raums verborgen. Mum war auf dem Markt gewesen: Sie trug einen schweren Korb auf der Hüfte, und mit der anderen Hand schleppte sie eine Einkaufstasche. Sie konnte mich nicht sehen, als sie hereinwankte, Korb und Tasche vor dem kleinen Einbaukühlschrank abstellte und sich stöhnend aufrichtete. Sie rief Dad. Keine Antwort. Sie wusste, dass er seine Hörgeräte nicht eingesetzt hatte, aber das kümmerte sie nicht. Für sie war seine Schwerhörigkeit bloß ein Mangel an Bemühen. „Er versucht es ja nicht mal“, sagte sie oft.
Sie rief noch mal, lauter und gereizter. „Beeil dich! Du bist schon seit Ewigkeiten da draußen.“ Sie wartete auf eine Antwort, obwohl sie gar keine Frage gestellt hatte. „Ich hab alles erledigt. Alles, was auf der Liste stand. Ganz allein.“ Stille. „Wo bist du? Was machst du?“
Dad öffnete die Hintertür und streckte den Kopf herein. Er sah mich, sagte aber nichts.
Mum bemerkte ihn. „Stell deine Stiefel nicht da ab.“
„Ich habe meine Stiefel nirgendwo abgestellt. Noch nicht.“
„Hast du Miranda gesehen?“
„Was?“ Er legte eine Hand hinter das Ohr. Dann drehte er sich um und zwinkerte mir zu.
„Miranda. Deine Tochter. Hast du sie gesehen?“
Er dachte eine Weile nach. „Ich glaube nicht. Noch im Bett, nehme ich an. Oder nein, vielleicht habe ich sie doch gesehen. Sie ist in die Stadt gefahren. Oder war das gestern?“
„Ich bin in die Stadt gefahren, nicht Miranda.“
„Sie wird bestimmt irgendwann auftauchen.“ Er kam herein und tat, als würde er mich jetzt erst bemerken. „Ah, da bist du ja!“ Und dann zu Mum: „Siehst du? Ich habe ja gesagt, sie wird irgendwann auftauchen.“
Ich hustete und winkte den beiden stumm zu.
Mum sah adrett, aber erschöpft aus. Sie wandte sich zu mir, während sie geschäftig die Einkäufe sortierte. Dabei gerieten die Knöpfe an der Vorderseite ihres Kleides unter Zug, sodass sich augenförmige Hautfenster öffneten. „Ich hab gar nicht gesehen, dass du da herumschleichst. Na, schön ausgeschlafen?“ Das war ihr subtiler Hinweis darauf, dass ich im Gegensatz zu ihr nicht bei Sonnenaufgang aufgestanden war. Sie wartete nicht auf eine Antwort, sondern schob Dad mit dem sandalenbewehrten Fuß den Korb zu. „Das alles kannst du wegräumen.“ Er kniete sich hin und begann, die Sachen im Korb mehr oder weniger willkürlich im Kühlschrank zu verstauen. Mum überwachte das Ganze, beugte sich unvermittelt hinunter und riss ihm einen Rotkohl aus der Hand. „Nein, das nicht.“
„Aber du hast gesagt das alles.“
„Ja, aber ich habe natürlich nicht alles gemeint.“
„Na gut, dann räume ich eben nur das alles in den Kühlschrank und den Rest nicht.“
„Und das ist für den Gefrierschrank“, sagte sie und gab ihm eine Plastiktüte.
„Das alles? Oder nur das?“ Er nahm die Tüte und sah hinein. „Manchmal frage ich mich, warum wir all dieses frische Fleisch und Gemüse kaufen, wenn wir es dann einfrieren. Ich meine, warum kaufen wir nicht gleich Tiefkühlzeug?“
„Das ist besser für den Metzger, da bleibt er im Geschäft.“
„Ja, aber ist es auch besser für uns? Könnten wir nicht mal was essen, bevor es eingefroren wird?“
„Du würdest den Unterschied gar nicht merken. Ich könnte dir ein Stück Pappe geben, und du würdest den Unterschied nicht merken.“
„Das kommt darauf an, ob du die Pappe kochen würdest. Oder würdest du sie einfrieren? Also, wenn wir frische Pappe hätten, könnte ich –“
„Raus.“
Mit raus meinte sie das, was bei ihnen die Buanderie hieß, dabei war es kaum mehr als ein an die Küche angebauter Schuppen. Darin gab es jede Menge alte Eiscreme-Eimer, ein Regal für Saatkartoffeln und eine Reihe kaputter Kaffeemaschinen. In einer Ecke stand ein glänzender neuer Gefrierschrank, zum Schutz vor den Fledermäusen mit einem verblichenen Stück Stoff abgedeckt. Sie schob Dad aus der Küche und schloss, noch immer Instruktionen gebend, die Tür. „In die oberste Schublade, nicht in die unterste, wo viel Platz ist. Den brauche ich für meine Johannisbeeren.“ Sie hielt inne, hörte ihn hantieren und fuhr fort: „Und lass bloß nicht die Bösen Katzen –“
Dad kam zurück, in der Hand die leere Plastiktüte. „Ich hab alles in die unterste Schublade getan – in den oberen war kein Platz mehr“, sagte er, während ein Strom von Katzen seine Beine umspülte. Die Bösen Katzen streiften im Garten herum, nie weit entfernt von der Küchentür, immer auf die Gelegenheit zu einem kollektiven Überfall lauernd, der ein bisschen Wärme und ein paar Happen Trockenfutter versprach. Hodge und Juno, die Hauskatzen, sollten die Katzenklappe eigentlich bewachen, sahen dem Treiben aber meist nur träge aus der Ferne zu.
„Du hast sie reingelassen! Steh doch nicht da rum. Husch, husch – raus mit euch, und zwar alle. In der untersten? Und was hab ich dir gesagt?“
Dad betrachtete freundlich das getigerte Rudel zu seinen Füßen. „Na dann, raus mit euch. Tut, was man euch sagt. Wie wir alle.“
„Wirklich, du lässt sie machen, was sie wollen. Wenn es nach dir ginge, würden sie das Haus übernehmen. Du musst die Sachen umräumen und irgendwie Platz in der oberen Schublade finden. Also los, raus mit euch.“
Ob sie nun Dad meinte oder die Katzen – jedenfalls trotteten alle gehorsam hinaus.
Ihre erste Kühltruhe hatte Mum 1971 in Oxford angeschafft, ein gewaltiges Ding mit einem schokoladenbraunen Resopaldeckel. Sie war Boswell getauft worden, nach dem Geschäft, in dem Mum sie gekauft hatte. Im Lauf der Jahre war der Deckel von Braun zu Beige verblasst und hatte nicht mehr richtig geschlossen, sodass man ihn mit einem Ziegelstein hatte beschweren müssen. Der Motor hatte unter der ständigen Belastung geseufzt und gestöhnt, und doch hatte das Ding meine Eltern bei ihrem Umzug nach Frankreich begleitet und dort noch zwanzig Jahre durchgehalten. Nachdem wir jahrelang suspektem Essen ausgesetzt gewesen waren, hatten meine Schwester und ich schließlich in einem von Eigennutz geschmälerten Akt der Großzügigkeit einen schicken Gefrierschrank gekauft und Mum zum Geburtstag geschenkt. Die Leute vom Lieferservice hatten strikte Anweisung gehabt, die Boswell mitzunehmen.
Mum hockte vor dem offenen Kühlschrank und kramte darin herum. „Dein Vater wird schrecklich unbeholfen“, sagte sie über ihre Schulter. „Und vergesslich.“ Ich hielt ihr die Hand hin, um ihr aufzuhelfen, doch sie reichte mir eine Untertasse mit einem grauen Stück Pastete, das es zum Mittagessen geben sollte. Bestimmt hatte Hodge sie am Morgen verschmäht. „Und du solltest wirklich mal was zu diesen grauenhaften Hausschuhen sagen. Wie kann man so was nur tragen?“
Dad kam wieder herein. Seine Hausschuhe waren tatsächlich grauenhaft. Mum zeigte auf sie. „Du sollst mit denen nicht rausgehen, davon gehen sie kaputt.“
„Du hast doch gesagt, ich soll rausgehen.“
„Ja, aber nicht in Hausschuhen. Du bist alt genug, auf deine Schuhe achtzugeben, oder?“ Dad schwenkte die Plastiktüte und zog fragend die Augenbrauen hoch. „Streich sie glatt und räum sie weg, wenn du aufgehört hast, rein- und rauszurennen wie ein Kuckuck. Und? Hast du alles untergebracht? Diese blöden Schubladen sind eine solche Platzverschwendung. Die Boswell war viel praktischer.“
Er gab mir die Plastiktüte, damit ich mich darum kümmerte, und trocknete sich die Hände an einem Geschirrtuch ab. „Praktisch vielleicht, aber auch am Ende eines langen Lebens angekommen. Es wäre humaner gewesen, sie friedlich in England sterben zu lassen.“ Nachdem er mutig seine Meinung gesagt hatte, setzte er sich an den Küchentisch und tat, als würde er den Sämereienkatalog studieren.
„Ja“, warf ich ein, „und dann hättet ihr euch nach dem Umzug hier eine neue kaufen können.“
„Wir wollten aber gar keine neue – die alte war einwandfrei in Ordnung. Solide und haltbar, nicht wie die Sachen heute“, sagte Mum. „Außerdem hätten wir sie gar nicht zurücklassen können. Was hätten wir mit all dem Essen machen sollen?“
Dad sah von den mit Tomaten bedruckten Hochglanzseiten auf. „Deine Mutter hat recht: Was hätten wir mit all dem Essen machen sollen?“ Es war oft schwer zu sagen, ob er ehelichen Konflikten ausweichen wollte oder versuchte, sie anzuheizen.
„Es essen?“, schlug ich vor.
„Wir haben es ja gegessen, aber hier“, sagte Mum.
Das stimmte. Sie hatten England verlassen und nicht nur die Boswell, sondern auch ihren gesamten Inhalt mitgenommen. Man hatte ihr den Stecker gezogen und sie, noch immer vollgestopft mit Hähnchenschenkeln, in einen Lastwagen geladen, nach Dover und über den Ärmelkanal geschafft und schließlich durch halb Frankreich gekarrt. Zehn Tage später war sie hier angekommen, und Mum hatte den Stecker wieder in die Steckdose gesteckt, was ihr zufolge „vollkommen sicher“ war, denn schließlich war die Boswell die ganze Zeit geschlossen gewesen.
Sie kam mühsam hoch, musterte die Pastete, die ich noch immer in der Hand hielt, nahm dann ein Messer und kratzte die trockenen Stellen am Rand ab. „Außerdem war das vor zwanzig Jahren, und jetzt habe ich ja eure schöne neue. Das war eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich mal anzusehen, was da eigentlich drin war. Ich habe ein paar sehr interessante Sachen gefunden.“
„Leichen“, vermutete Dad.
„Sehr alte Leichen“, sagte ich.
„Sehr witzig, ihr beiden. Hier – wenn du das unbedingt lesen musst, mach dich nützlich.“ Sie legte mit Nachdruck einen Stift auf den Tisch. „Du kannst die Bohnen ankreuzen, die wir pflanzen wollen. Du weißt doch, welche wir wollen, oder?“ Sie wandte sich zu mir. „Als meine Mutter gestorben ist, hatte sie noch immer einen Topf Eier in Fischgelatine in der Garage.“
„Vielleicht ist sie daran gestorben“, sagte Dad und blätterte auf der Suche nach Bohnen im Katalog.
„Wozu das denn?“, fragte ich Mum.
„Das machte man so im Krieg. Man rührte in einem Topf Gelatine aus Fischhaut an und legte Eier hinein, damit sie sich länger hielten.“
„Ich denke, im Krieg gab es keine Eier.“
„Gab es auch nicht. Wenn man also welche kriegen konnte, behielt man sie“, sagte sie mit unerbittlicher Logik. „Es gab keine richtigen Eier. Nur Eipulver.“
Dad zögerte, den Stift in der Hand. Aßen sie lieber Spargelbohnen oder Windsor? Man konnte es nicht wissen. Sicher war nur, dass er es falsch machen würde. „Ah, Eipulver, ja!“, sagte er zur Welt im Allgemeinen. „Das hat ein bisschen wie Haarschuppen geschmeckt. Nur nicht so lecker.“
„Ich staune, dass ihr keine Lebensmittelvergiftung gekriegt habt“, sagte ich.
„Lebensmittelvergiftung?“, schnaubte Mum. „Als ich ein Kind war, kriegte man keine Lebensmittelvergiftung.“
„Wir hatten keine Zeit, an vergifteten Eiern zu sterben“, sagte Dad. „Diphtherie oder Polio waren schneller.“
Mit einem „Jetzt hast du ja wohl lange genug darin herumgekritzelt“ nahm Mum ihm den Katalog ab und schob ihn hinter die Obstschale. Sie hatte das Bestellformular schon vor einer Woche abgeschickt. „Die Leute sagen immer, dass man die Sachen nicht länger als ein paar Monate einfrieren darf, aber denkt bloß an Mallory.“ Wir sahen sie an und warteten auf eine Erklärung. „George Mallory. Everest, 1924. Als sie ihn achtzig Jahre später im Eis gefunden haben, hatte er noch immer seine Stiefel an und alles andere. Wenn etwas gefroren ist, kann es nicht verderben.“
„Ich glaube nicht, dass irgendjemand versucht hat, Mallory zu essen“, sagte ich.
„Tja, und keiner von uns ist tot.“
„Noch nicht, meine Liebe, noch nicht“, sagte Dad und hustete.
„Ich trinke meinen Kaffee im Wohnzimmer, vielen Dank“, sagte Mum, setzte energisch die Brille auf, ging hinaus und machte die Tür hinter sich zu.
–––––
Endlich waren Dad und ich allein und unbeaufsichtigt. Er stand auf und schlurfte in seinen viel geschmähten Hausschuhen zur Kaffeemaschine. „Ich frage mich, ob sie mich einfrieren wird, wenn ich tot bin.“
„Für dich ist da drin nicht genug Platz.“
„Vielleicht in der untersten Schublade, wenn wir die verdammten Johannisbeeren gegessen haben. Seit wir dieses schreckliche Ding haben, müssen sich unsere Därme weiterentwickelt haben. Sie sind jetzt imstande, billiges Fleisch zu verdauen, das beim Kauf schon abgelaufen war und dann eingefroren, aufgetaut und noch einmal eingefroren worden ist. Darwin. Der Stärkere überlebt. Ob es auf der Beagle wohl eine Gefriertruhe gab?“ Er streckte den Arm aus, um den Schrank über der Spüle zu öffnen. „Kaffee? Pass auf deinen Kopf auf, ich will nur eben –“ Ein Stapel Tassen und Untertassen glitt heraus und fiel zu Boden. „Mist.“
Er hob eine gewölbte Scherbe aus dünnem weißem Porzellan auf und betrachtete sie traurig. „Jetzt komme ich in die Hundehütte.“ Er reichte mir die Scherbe. „Steck sie in die Mülltonne. In die große, die draußen steht, sonst sieht sie es. Ganz nach unten, unter die Flaschen.“
„Sie wird bestimmt nichts merken. Es sei denn, sie zählt vor dem Zubettgehen die Tassen.“
„Bei den anderen hat sie nichts gemerkt.“
„Bei wie vielen anderen?“
„Schwer zu sagen. Zähl die Untertassen. Ich zerbreche immer nur die Tassen, nie die Untertassen. Und ich werfe nie eine Untertasse weg, sondern kaufe eine neue Tasse. Und wenn man eine Tasse kauft, kriegt man die Untertasse dazu. Irgendwann wird sie also merken, dass wir achtundsiebzig Untertassen, aber nur drei Tassen haben … Aber vielleicht liege ich dann schon in der untersten Schublade.“
Nach mehr als fünfzig Ehejahren waren sie in ihren Eigenarten gefangen wie Mallory im Eis. Es war ein Ringen zwischen Sturheit und Pedanterie, und jede Einmischung war sinnlos. Ich sah zu, während Dad mit der raumschiffartigen Kaffeemaschine kämpfte und mir schließlich zwei halb volle Tassen reichte. Ich gab in eine davon eine klitzekleine Menge Zucker, brachte beide ins Wohnzimmer und ließ ihn seine Tasse allein brühen. Mum hatte eine muntere Ragtime-Platte aufgelegt, die Dad besonders verabscheute, obwohl er sie ja eigentlich nicht hören konnte. Für ihn waren alle Formen von Jazz „Eiswagenmusik“.
Juno, die Schildpattkatze, saß auf Mums Schoß und grub die Krallen in ihre Oberschenkel. „Ich kann nicht aufstehen.“ Sie zeigte auf die Kaffeetasse in meiner Hand. „Stell sie auf das Kaminsims. Aber Vorsicht mit der Uhr.“
„Ich hab etwas Zucker reingetan“, sagte ich.
„Aber bitte nur ein bisschen. Hat dein Vater die Maschine richtig ausgeschaltet? Mit dem Knopf vorne und dem Schalter hinten?“
„Ja, bestimmt. Allerdings verstehe ich nicht, warum ihr sie überhaupt ganz ausschaltet.“
„Wegen dem roten Licht an der Vorderseite. Das kann man doch nicht die ganze Zeit brennen lassen – denk mal an die Stromkosten.“
„Ich glaube, wenn die das ganze Jahr brennen würde, käme vielleicht ein Euro zusammen.“
„Sag ich doch.“
Dad kam herein und schritt vorsichtig über die diversen rutschenden Teppiche. „Wo ist Hodge?“ Er sah zu dem leeren Hocker neben seinem Sessel. Vor dem kalten Kamin blieb er stehen und hielt Mum eine Tasse hin. „Hier.“
„Aber ich hab doch schon eine!“, sagte sie. „Das ist deine. Vorsicht mit der Uhr.“
Er stellte die Tasse auf das Kaminsims und rückte die leise tickende Reiseuhr zur Seite. Sie war vor vielen, vielen Jahren ein Verlobungsgeschenk gewesen. Er sah verwirrt aus. „Nein, das kann nicht meine sein. Ich hab Zucker reingetan.“
„Es ist ja nur Zucker. Und nur ein bisschen.“
„Ich werde mir eine neue machen.“ Er griff nach der Tasse.
„Du wirst diesen Kaffee doch wohl nicht wegschütten?“
„Natürlich nicht. Das wäre Verschwendung. Ich werde ihn trinken, während ich mir einen neuen mache.“ An der Tür drehte er sich noch einmal um und sagte: „War das gestern nicht ein leckeres Abendessen, Miranda? Deine Mutter nennt es blonkett de vo, aber ich würde es eher als Schmortopf bezeichnen. Wie fandest du denn das Fleisch?“ Er schloss leise die Tür hinter sich. Mum sah mich erwartungsvoll an.
„Sehr … zart?“, sagte ich.
Ein triumphierendes Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Sie strich mit fester Hand über Junos knochigen Rücken. „Kalbskoteletts, tiefgekühlt. 1983.“
JULI
Bevor ich fortfahre …
Bevor ich fortfahre, sollte ich Ihnen vielleicht die Besetzungsliste geben. Da wir keine sehr fruchtbare Familie sind, ist sie kurz:
Dad: emeritierter Professor der Philosophie, Ende siebzig
Mum: seine Frau, zwei Jahre jünger
Charlotte: Anfang fünfzig, Tochter Nr. 1
Miranda (das bin ich): nicht ganz fünfzig, Tochter Nr. 2
Alice (meine Tochter): nicht ganz zwanzig, Chemiestudentin
Ich war zwanzig und noch in London auf der Schauspielschule, als ich beschloss, nach Paris zu ziehen. Ich wollte Schauspielerin werden und England und allen oben Genannten (mit Ausnahme von Alice, die es noch nicht gab) entkommen. Die Schauspielerei war in vielerlei Hinsicht bereits eine Flucht vor der Realität, aber das reichte mir nicht; ich wollte eine Distanz, die in Kilometern zu messen war. Kaum hatte ich das Land verlassen, da ging Dad überraschend in Vorruhestand. Er hatte sich immer schon über die dummen, oberflächlichen Studenten beklagt, die den Unterschied zwischen philosophischer Logik und der Philosophie der Logik nicht mal erkannten, wenn sie sich daraufsetzten. Er sagte, er habe genug und werde seine Zeit nicht mehr an andere verschwenden, sondern seinen eigenen Interessen nachgehen und über etwas nachdenken, das er reichlich nebulös, wie ich fand, als „validen Schluss“ bezeichnete. Meine Eltern verkauften das große Backsteinhaus in Nord-Oxford, in dem sie seit meiner Geburt gelebt hatten, und folgten mir nach Frankreich.
Sie kauften ein großes, heruntergekommenes manoir mit einem zugewachsenen Garten am Rand eines Weilers in der französischen Provinz. Die Zivilisation (in Form von Bahnhof und Geschäften) war eine halbstündige Autofahrt entfernt in Poitiers. Damals konnte keiner von beiden fahren, und es war klar, dass einer es würde lernen müssen.
Das Haus hieß La Forgerie, bestand aus den regional üblichen cremeweißen Steinen und hatte ein Schieferdach und am Ende einen Turm. Es war Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut worden, und seitdem war, abgesehen von der Installation verschiedener Bäder und Toiletten, anscheinend nicht viel verändert worden. Obgleich es mit seinen drei Etagen, den hohen Fenstern und den hellgrauen Fensterläden vom Garten aus imposant wirkte, war es nicht so groß, wie es schien. Auf der anderen Seite, wo die geschotterte Zufahrt endete, befanden sich keine Zimmer, sondern lange, mit Fenstern versehene Flure. Das verlieh dem Haus etwas von einem Eisenbahnwagen aus vergangenen Zeiten. Im Erdgeschoss reihten sich aneinander: Küche, Treppenhaus, Esszimmer, Wohnzimmer und Musikzimmer (in dem nur ein ungestimmtes und unstimmbares Klavier stand), allesamt mit Marmorkamin, Eichenparkett und hoher Decke. In der ersten Etage gab es eine ähnliche Aufteilung in vier Schlafzimmer und zwei Bäder. Und ganz oben, unter dem Dach, waren die ehemaligen Dienstbotenzimmer, die durch Türen miteinander verbunden und jetzt komplett von Dads Bibliothek in Beschlag genommen waren. Es gab dort ein durchgesessenes Sofa und einen quietschenden Bürostuhl, der an seinem Schreibtisch mit dem Computer stand. Zwischen den Bücherregalen hingen Landkarten des alten Griechenlands. Die Dielen waren ungewachst, und eine Heizung gab es nicht – das hätte den Büchern geschadet.
Am Ende des Hauses stand der zugige Turm. Er enthielt nur ein zweites Treppenhaus, in dem alte Esszimmerstühle und mit Schnur zusammengebundene Zeitungsstapel lagerten. Die Tierwelt war reichlich vertreten: Fledermäuse, Wespen, Mäuse und einmal auch ein Eichhörnchen hatten hier schon genistet. Ranken hatten die selten geöffneten Fensterläden überwuchert und suchten einen Weg hinein.
In den ersten Jahren hatten meine Eltern die Räume im Erdgeschoss tapeziert, einen neuen Boiler installiert, das Dach des Entenhauses repariert und auf dem oberen Feld einen Tennisplatz anlegen lassen. Sie adoptierten zwei Lamas namens Lorenzo (genannt Lollo) und Leonora, die kamen und uns zusahen, wenn wir Tennis spielten. Meist traten beide Eltern gegen eine Tochter an, und immer war es Mum, die die Punkte zählte – auf ihre eigene unnachahmliche Art. Die Lamas wandten die Köpfe auf den langen Hälsen hin und her und sahen zu, während wir Menschen rätselhafterweise auf etwas eindroschen, das wie ein Apfel aussah.
Die Renovierungsmaßnahmen stockten und kamen schließlich ganz zum Erliegen. Im Lauf der Zeit wurden die Besuche von Freunden aus England seltener. Manche waren zu alt – das Haus war nicht leicht zu erreichen –, andere waren gestorben oder in weit entfernte Länder gezogen. Schlaf- und Badezimmer wurden eins nach dem anderen außer Betrieb genommen, und ich konnte mir vorstellen, dass sie in nicht allzu ferner Zukunft in einem Wohnschlafzimmer inmitten eines großen Landhauses leben würden.
Inzwischen war ich eine kompetente, aber uninspirierte französische Schauspielerin geworden. Ich muss fünf- oder sechsundzwanzig gewesen sein, als ich zum ersten Mal in einer professionellen Produktion auf der Bühne stand. Das Stück war Die Möwe, aber ich war Masha und hatte wenig Text. Ich stellte mir vor, dass Mum und Dad kommen würden, um es sich anzusehen. Vor meinem geistigen Auge saßen sie mit Hut und Mantel und steinernen Gesichtern auf ihren Plätzen, zwei Miesepeter in einem Meer fröhlicher Gesichter. Ich war besorgt: Wie sollte ich auf der Bühne stehen und sie nicht ansehen? Wie sollte ich vom elterlichen Blick nicht abgelenkt sein? Und danach – würden sie mir ehrlich sagen, ob es ihnen gefallen hatte? Würden sie mich bestärken, auch wenn sie gerade drei Stunden Tschechow verschlafen hatten? Würde vielleicht sogar ein kleines bisschen elterlicher Stolz aufblitzen, weil ich auf der Bühne gestanden und Applaus bekommen hatte?
Ich hätte mir die Sorgen sparen können – sie kamen nicht. Es gab immer einen guten Grund, warum es gerade nicht ging; einmal rettete sie ein Eisenbahnerstreik, ein anderes Mal hatte Dad eine üble Erkältung. Und als es ihnen schließlich passte, stellten sie fest, dass die Spielzeit vorbei war. „Oh! Zu spät – jetzt haben wir dich verpasst!“
Ich dagegen besuchte sie ziemlich oft. Für ein Wochenende, selten für länger. Ich lebte in Paris, und die Fahrt mit dem TGV dauerte nur ein paar Stunden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich sie besuchen wollte oder sollte, sondern dass ich sie besuchen wollen sollte, also besuchte ich sie. Aber wie Dad auf seine philosophische Art sagen würde: Was meinte ich eigentlich mit sollte?
Im Lauf der Jahre hatten sie eine erprobte Technik des Zusammenlebens entwickelt. Es war ein Zwei-Personen-Stück, aber es gab auch eine kleine Nebenrolle für mich. Sie waren wie zwei Scherben eines zerbrochenen Tellers, die nicht zusammenpassten und vielleicht nie gepasst hatten und mich nicht so sehr als Klebstoff, sondern vielmehr als Dolmetscherin brauchten. Ich ertappte mich oft dabei, dass ich ihre Wünsche und Beschwerden an den jeweils anderen weitergab.
Meine Schwester Charlotte war vier Jahre älter und in fast jeder Hinsicht erstaunlich anders als ich. Sie hatte einen langen, geraden, unvorstellbar perfekt geflochtenen Zopf gehabt, der ihr über den Rücken hing. Ich hatte davon geträumt, ihn abzuschneiden, wenn sie nicht damit rechnete. Mein störrisches Haar wurde immer möglichst kurz geschnitten, und zwar in der Küche, von Mum, mit der Küchenschere. Wir wurden älter, und Charlotte schnitt sich den Zopf schließlich selbst ab, aber die Unterschiede zwischen uns blieben. Sie lebte allein und in sicherer Entfernung, nämlich in Bicester. (Ja, sie war mein Geschwister in Bicester – eine verlockende erste Zeile für einen Limerick.) Ihre Kinder, zwei sportliche Jungen, waren erwachsen, der dazugehörige Vater hatte sich schon vor Jahren aus dem Geschehen verabschiedet. Die geografische Distanz zwischen uns half, unsere geschwisterliche Rivalität in eine geschwisterliche Einigkeit zu verwandeln. Was uns einst getrennt hatte – unsere Eltern –, brachte uns jetzt zusammen. Sie wurden älter und zu unserer Schnittmenge, unserer Gemeinsamkeit.
Charlotte hatte selten das Gefühl, sie sollte nach Frankreich fahren. Oder vielleicht hatte sie das Gefühl, sie sollte selten fahren. Im Ergebnis war es dasselbe.
Charlotte zu schreiben war meine Methode, der Frustration Luft zu machen, die sich nach einem Wochenende in La Forgery aufgestaut hatte. Katharsis wäre wohl das richtige Wort. Mum hätte gesagt: „Viel Theater um nichts.“
–––––
Von: MIRANDA
An: CHARLOTTE
Datum: Dienstag, 17.07.2018 11:15
Betreff: Ab nach Bolivien
Nur ein schneller Brief, während ich den Rucksack packe. Die Produktion, in der ich war, ist vorbei. Es war ein entsetzlich langweiliges Stück, aber so ist das Leben als Schauspielerin: Man nimmt, was man kriegen kann, und dann beklagt man sich darüber. Morgen fliege ich über Lima nach La Paz, übermorgen bin ich dort. Ich habe viele warme Strümpfe und vier Bände von Das Juwel der Krone mitgenommen; das wird mir in den Anden Kraft geben. Ah! Ich werde einen ganzen Monat kreuz und quer durch den Altiplano reisen, allein und ohne mir Gedanken über andere Leute und andere Schauspieler machen zu müssen – das klingt paradiesisch.
Es war wieder mal ein langes, deprimierendes Wochenende in La Forgerie. Mum war in Bestform. Beim Frühstück ging es um den neuen Gefrierschrank (die Boswell war viel besser, etc., etc., du kennst die Leier) und darum, wie verschwenderisch Dad und ich sind. (Im Krieg war das anders, wir haben nie irgendwelche Süßigkeiten oder Bananen oder Schokolade gekriegt. Gestern gab’s Marmelade, und morgen wird’s welche geben, aber heute gibt’s keine.) Denkt sie, wir können nicht rechnen? Man könnte meinen, dass sie diejenige war, die den Bombenkrieg erlebt hat, und nicht Dad. Sie war ein Baby, als der Krieg vorbei war, auch wenn sie sich an die Rationierungen noch erinnern kann. Hast du je von „Eiern in Fischgelatine“ gehört? Ich auch nicht. Ich hab nachgeforscht: Es hat was mit Fischhäuten zu tun. Igitt!
Am Samstag nach dem Abendessen hat sie sich ein tolles Ding geleistet. Ich hab die Messer abgewaschen – wie immer von Hand, weil „es die Griffe ruiniert, wenn man sie in die Maschine tut“. Dasselbe gilt natürlich für die Gabeln und Löffel. Und die Teller sind empfindlich und müssen schonend gespült werden. Desgleichen die Gläser, damit sie keine Kratzer kriegen. Also kommen nur Töpfe und Katzenschüsseln in die Maschine, und der ganze Rest wird von Hand abgewaschen, mit dem schmutzigen Schwamm, der mal gelb war, als sie ihn 1965 bei Shergold gekauft hat. Ich machte also den Abwasch, und irgendwann juckte mein Auge, und ich rieb mit dem seifigen Finger darüber. In einem Anfall von Wahnsinn sagte ich Mum, ich hätte das Gefühl, als würde ich ein Gerstenkorn bekommen. Sofort eilte sie herbei und fummelte mir mit Fingern, mit denen sie wahrscheinlich gerade eine Packung Schneckenkorn geöffnet hatte, am Auge herum. „Ja, das ist ganz gerötet. Aber ich hab eine Salbe dafür.“ Widerstand war zwecklos. Schon holte sie ihre „Medizinkiste“ (= rostige alte Keksdose) aus dem Schrank unter der Treppe und brachte mir eine kleine Tube mit langer, spitzer Tülle – so alt, dass die Farbe abgeblättert war und man die Aufschrift nicht mehr lesen konnte. „Das mache ich vor dem Badezimmerspiegel“, sagte ich. Ich ging rauf, machte die Badezimmertür zu und wartete ein paar Minuten, dann ging ich wieder runter, sagte vielen Dank und fragte, wohin ich die Tube tun sollte. Sie zeigte auf eine Schachtel, die auf dem Küchentisch lag. Darauf stand, in krakeliger Kugelschreiberschrift (und das ist wirklich wahr): „2 x täglich, für Cornelius“. Sie hatte mir eine uralte Salbe gegeben, die für eine Katze bestimmt gewesen war. Eine Katze, die seit fünf Jahren tot ist. Ich zeigte sie Dad. Er sagte: „Leg sie wieder zurück und sag vielen Dank. Das ist leichter. Viel leichter.“
Ich tat die Tube in die Schachtel, die Schachtel in die Keksdose und die Keksdose in den Ali-Baba-Schrank unter der Treppe, wo ich, neben einem beeindruckenden Sortiment von Glühbirnen, rostigen Backofenspraydosen, Putzlumpen und Silberputzmittel, Folgendes fand:
● einen fürs ganze Leben ausreichenden Vorrat an Plastiktüten, zusammengeknüllt und in eine größere Plastiktüte gestopft
● eine Schachtel mit Spritzen, die Dad mal für eine Entzündung am Bein verschrieben bekommen hat
● 17 Rollen Backpapier (allesamt angebrochen)
● eine beeindruckende Sammlung von Schnüren in den verschiedensten Längen, Stärken und Farben, alle einzeln zu kleinen Knäueln aufgewickelt
● allerlei Geräte zum Töten von Fliegen, Wespen, Maulwürfen und Mäusen
● einen verstoßenen Toaster, in dem noch zwei Scheiben Toast steckten
● ein Bügeleisen mit englischem Stecker
● einen Föhn ohne Stecker
Keine leeren Marmeladengläser, Zeitungen, Eiscreme-Eimer und Eierkartons, sagst du? Nein, natürlich nicht – diese Sachen werden draußen, in der Buanderie, aufbewahrt, wo mehr Platz ist.
Ein kurzer Austausch beim Frühstück, der dir gefallen könnte:
Dad: Warum kriegen die Katzen eigentlich diese teure frische Milch und wir nur die H-Milch aus dem Tetrapak?
Mum: Sie mögen keine H-Milch.
Dad: Ich auch nicht.
Mum: Du magst weder die eine noch die andere. Du trinkst keine Milch.
Dad: Das tut nichts zur Sache.
Oder wie wär’s hiermit, ich und Mum nach dem Mittagessen auf dem Sofa:
Mum (liest die Zeitung): Hier steht, dass ein neuer Steve-McQueen-Film kommt, aber das kann nicht stimmen – er ist ja tot.
Ich: Vielleicht meinst du einen anderen Steve McQueen.
Mum: Steve McQueen. Die glorreichen Sieben. Du weißt schon: Da da, dum di da DA, da da, dum di DA DA. Vielleicht bist du zu jung. Aber ich bin sicher, dass er tot ist.
Ich: Du meinst den Schauspieler Steve McQueen, nicht den Regisseur. Das ist jemand anders. Er macht Filme, aber er ist kein Schauspieler. Er hat einen Film über die Sklaverei in Amerika gemacht, der hieß Twelve Years a Slave. Er ist schwarz. Und nicht tot.
Mum: Sei nicht albern. Steve McQueen ist nicht schwarz. In Die glorreichen Sieben jedenfalls war er’s nicht.
Ich muss sagen: Sie sind vielleicht völlig verrückt, aber wenn ich dort war, habe ich immer ein paar gute Anekdoten zu erzählen. Bin jetzt wieder in Paris, sicher und geborgen und NICHT an Lebensmittelvergiftung gestorben.
Liebe Grüße
Miranda
P. S.: Noch immer nicht tot, aber frag mich morgen noch mal …
–––––
Oxford, Oktober 1962
Liebe Kitty,
liebe, liebe Kitty! Ach, was für ein Glück ich habe. Eine neue Welt öffnet sich. Neue Freunde und keine Familie. Was für ein Glück ich habe, hier zu sein und Dich zu haben. John und Matthew zu schreiben, wäre hoffnungslos, ganz hoffnungslos, das weißt Du. Sie sind beide sehr charmant, aber auch alberne junge Burschen und außerdem natürlich Brüder. Während Du eine Schwester bist. Und alt und weise. Ich meine das so freundlich, wie es nur geht – ich weiß ja, dass Du nicht alt bist, aber Du bist älter und weiser als ich. Und Du bist schon fort von zu Hause, also verstehst Du mich.
Ich hatte eine hübsche, saubere Stadt erwartet, sanft durchflossen von alten Bächen, aber was ich am Bahnhof sah, waren ein Wimpy und überquellende Mülleimer. Die Einfahrt in den Bahnhof war so trostlos und deprimierend, dass es auch irgendeine andere Stadt hätte sein können. Und der Bahnhof war gar nicht wie der zu Hause, mit dem Stationsvorsteher und seiner Katze und seinen Blumenkübeln, auf die man sich nicht setzen darf. Hier spricht niemand mit einem, und alle haben es eilig, weil sie wissen, wohin sie wollen – nur ich nicht! Ich fragte nach dem Weg, und man wies unbestimmt auf eine Brücke und dann nach links. Ich folgte den Anweisungen und marschierte durch den Regen, die Wagen zischten vorbei und spritzten meine Beine nass. Nein, eigentlich zischten sie nicht vorbei, ich ging die ganze Zeit an einem Verkehrsstau entlang. Die Wagen und Busse standen bloß da und bebten. Als ich vor der Adresse stand, die man mir gegeben hatte, war ich völlig durchnässt. Mein Unterhemd juckte, die Strümpfe waren bis zu den Knöcheln runtergerutscht, und meine Haare standen in alle Richtungen. Da waren ein großer Torbogen und ein schmiedeeisernes Tor, schwarz und golden glänzend, und darüber hing das Wappen des Colleges. Ich ging über große Steinplatten zum Portal, sah aber nirgends eine Klingel, also drückte ich gegen die Tür (noch mehr glänzender schwarzer Lack), und sie schwang auf. Drinnen war es weniger prächtig. Ich ging zur Pförtnerloge und nannte einem grimmigen alten Drachen meinen Namen. Sie sah in einem Buch nach und führte mich recht widerwillig nach oben. „Toilette hier, Waschraum da. Nur kaltes Wasser, sparsam verwenden, nachts verboten. Vorsicht auf der Stufe hier – da fehlt eine Teppichstange.“ Dann war ich mir selbst überlassen.
Ich setzte mich auf das harte Bett (das nennen sie Matratze? Fühlt sich eher an wie alter Toast), und plötzlich wurde mir bewusst: Ich war in meinem eigenen Zimmer mit meinem eigenen Fenster und meinem eigenen kleinen Schlüssel in der feuchten Hand. Ich setzte den Hut ab und sah hinaus. Hinter den Baumwipfeln ragte irgendwas Schauerromanhaftes auf. Verwegen beschloss ich, das Fenster aufzureißen und mich von Oxford umfangen zu lassen. Das Aufreißen klappte nicht gleich – die Gewichtsschnur war gerissen, und ich musste mit dem Handballen fest gegen den Rahmen schlagen wie beim Tor der Pferdekoppel –, aber schließlich war es offen, und ein Schwall grauer Luft kam herein, eine Mischung aus Lindenblüten und Benzin, nassen Schuhen und kaltem Tee. Ich war angekommen.
xxx, Deine Dich liebende Schwester
–––––
Oxford, Anfang November 1962
Liebe Kitty,
ich weiß, dass ich nicht dumm bin, aber ich weiß auch, dass ich nicht so intelligent bin – ich meine, nicht so intelligent, dass sie mich genommen hätten, wenn Guteronkel nicht irgendwelche Strippen gezogen hätte. Er hat zwar nichts davon gesagt, aber da er hier so viele Leute kennt, bin ich sicher, dass er meinen Namen ein Stück nach oben gerückt hat. Du solltest die anderen Studentinnen sehen – so ernst, so vernünftig und entschlossen. Wahrscheinlich muss man als Mädchen so sein: Wir müssen beweisen, dass wir es verdienen, hier zu sein, während es für die Jungen (die Männer, sollte ich sagen, denn sie haben Bartstoppeln und Pfeifen) ganz selbstverständlich ist. Wir bekommen sie nicht oft zu sehen und müssen natürlich um zehn zu Hause sein, aber hin und wieder kreuzen sich unsere Wege. Sie scheinen mehr Zeit auf dem Fluss als in der Bibliothek zu verbringen, und wenn man rudern kann, muss man nicht intelligent sein. Eine Option, die den Damen nicht offensteht – Rudern gilt als „unangemessen“. Na ja, man kann rudern, aber ganz sicher nicht schnell. Als Mann dagegen muss man schnell rudern.
Ich muss akzeptieren, dass ich, wenn ich hier zurechtkommen will, ernster und vernünftiger als die Männer sein muss. Ich muss genauso hart arbeiten, darf aber nur weniger erwarten; ich muss akzeptieren, dass ich eher weniger als mehr haben werde. Alle, die ich bisher kennengelernt habe, sind wie Mr. Toad: forsch und laut. Die meisten kommen geradewegs von irgendwelchen Eliteschulen und denken, dass ihnen all dies – und dazu alles, was es ihnen später ermöglichen wird – einfach zusteht. Bevor ich hierherkam, habe ich nie darüber nachgedacht, auf welcher Sprosse der Lebensleiter ich stehe. Ich dachte immer, ich würde auf die richtige Art von Schule gehen, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich bin mir bei gar nichts mehr sicher. Die Mr. Toads dieser Welt dagegen sind sich immer sicher. Sie marschieren einfach weiter, ohne sich noch mal umzudrehen – sie wissen, dass sie die richtigen Kleider und die richtigen Haare haben. Sie fahren in Booten herum und lesen die richtigen Bücher. Für sie ist gesorgt, da fragt niemand nach. Und was ist mit mir? Dem armen Maulwurf, der nach dem Frühjahrsputz aus seinem Haus tritt? Wird Ratty vorbeischauen und mir den Fluss zeigen? Ich weiß es nicht, noch nicht.
Was meinst Du? Werde ich es hinkriegen?
xxx, DDlS
–––––
Oxford, Ende November 1962
Liebe Kitty,
ich bin die Einzige hier, die selbst geschneiderte Sachen trägt, aber über so was spricht man nicht. Sie sehen es, aber sie sagen nichts. Niemand sagt mir, dass mein Strumpf eine Laufmasche oder mein Handschuh ein Loch hat. Tatsächlich trägt niemand Handschuhe, ganz anders als in der Schule. Gestern habe ich gemerkt, wie besonders schrecklich mein Rock aussieht. Als ich ihn genäht habe, kam vom Oberkommando die Order, ich soll beim Zuschnitt zwei Zentimeter zugeben, damit ich „noch reinwachsen“ kann. Glaubt sie wirklich, dass ich mit achtzehn noch in irgendwas reinwachse? In die Breite vielleicht, aber nicht in die Höhe. Es muss ein Alter geben, in dem man in nichts mehr reinwachsen kann, egal, was es ist. Man ist, was man ist – Punkt. Jetzt hat der Rock am Bund ein paar Falten, und mit dem Reißverschluss war ich noch nie ganz zufrieden, darum ziehe ich meinen Pullover immer ganz runter. Trotzdem ist es der beste Rock, den ich habe, und der einzige, für den wir Stoff gekauft haben, anstatt einen alten Mantel oder die Kinderzimmervorhänge zu verarbeiten. Für mich ist er mein Weggehrock – und jetzt, wo ich tatsächlich weggegangen bin, kann ich den Saum kürzen.
Das Beste hier ist, dass niemand über den Krieg spricht. Zu Hause gab es kein anderes Thema: der Krieg der Krieg der Krieg der Krieg. Ich kann mich nicht an den Krieg erinnern, und er ist mir auch egal. Wir waren weit weg, auf einem anderen Kontinent, und außerdem ist das alles ewig her. Ich war noch nicht geboren, und wir waren nicht in England, und als wir wieder da waren, haben wir ja nicht in Coventry oder London gelebt – Hereford war nach dem Krieg bestimmt nicht anders als vorher, oder?
Du hast Glück: Du hast das erste Haus noch erlebt, vor Hereford, vor England. Ich wollte, ich könnte das auch sagen. Ich kenne nur die Fotos. Die Hochzeit: Pa und OK stehen im fleckigen Licht vor der Schule, beide in ihren besten Sachen und ohne ein Lächeln. Es gibt sogar eins von mir, einem winzigen, krabbenartigen Wesen, das sich an OKs Busen schmiegt. Gibst Du mir recht, wenn ich sage, dass sie einen Busen hat? Kein anderes Wort passt. Für mich ist sie nicht „Mutter“ oder „Mama“, aber dass sie von uns allen, einschließlich Pa, erwartet, dass wir sie OK nennen, ist schon ein bisschen seltsam, oder? Das Oberkommando, wo alles entschieden und organisiert wird. Sie lässt keinen Raum für Wärme, Geborgenheit und Gemeinschaft. „Im eigenartig duftenden Schatten des großen, dunklen Johannisbrotbaums“ – so heißt es doch bei D. H. Lawrence, oder? Ich frage mich, wie ein Johannisbrotbaum aussieht. Habe ich dorthin gehört? Ich nehme an, das ist der Sinn eines Empires: dass es anders ist als zu Hause, meine ich.
Hier sind alle entweder wie ich zu jung, um über Luftangriffe und Bomben zu reden, oder so alt und verknöchert und mit ihren Kreuzworträtseln beschäftigt, dass sie sich nicht mehr erinnern, was sie gestern gemacht haben, ganz zu schweigen von vor zwanzig Jahren – und damals wären sie ohnehin zu alt gewesen, um zu kämpfen. Nein, das ist nicht fair, sie sind nicht alle so alt – mein Tutor zum Beispiel ist ziemlich jung und lebhaft –, aber hier kommt einem alles so vor, als wäre es schon seit Jahrhunderten da – was ja auch stimmt – und als wäre der Krieg bloß eine kurze, schon vergessene Störung gewesen.
Im Korridor hängt neben der Pförtnerloge ein Foto aus der Zeit, als das College ein Lazarett war. Auf dem Rahmen steht: „1943 – Lazarett für Kopfverletzungen“. Zwei Schwestern stehen in weißer Tracht mit einem roten Kreuz auf der Brust hinter zwei sitzenden Soldaten. Der eine trägt Uniform und Stiefel, der andere hat seinen Morgenrock an und eine Decke über den Beinen, also ist er vermutlich die Kopfverletzung. Im Hintergrund sieht man Infusionsständer und Eisenbetten auf Rädern, und das Witzige ist, dass das Foto im Garten hinter dem Haus aufgenommen worden ist – man sieht sogar mein Fenster mit der gerissenen Gewichtsschnur. Glaubst Du, sie haben sie jeden Tag rausgefahren an die frische Luft? Oder mussten sie im Garten schlafen? Manchmal frage ich mich, ob eine Kopfverletzung in meinem Zimmer gestorben ist. Wenn ja, dann hoffe ich, sie ist nicht unschön, sondern romantisch gestorben.
Hier reden alle unentwegt über die neue Umgehungsstraße, die vielleicht gebaut oder auch nicht gebaut werden wird (gar nicht so romantisch oder intellektuell), und alle finden es eine Sehr Schlechte Idee. Aber das hat man auch 1830 über die Eisenbahn gesagt. Und wahrscheinlich über alle anderen Erfindungen seit 1066, mit Ausnahme der Druckerpresse. Im Grunde soll sich nichts ändern. Mit einem Dozenten hatte ich eine Diskussion über die Umgehungsstraße. Ich sagte: „Wenn es eine Umgehungsstraße gäbe, wäre es leichter, hierherzukommen, oder?“ Und er antwortete: „Aber sehen Sie, es wäre uns lieber, wenn andere Leute nicht hierherkommen würden.“ Das fasst Oxford ziemlich gut zusammen. (Gerade denke ich, dass ich hätte sagen können: „Ist nicht der Sinn einer Umgehungsstraße, dass die Leute einen leichter umgehen können?“ Aber solche Schlagfertigkeiten fallen mir immer erst einen Tag später ein …)
xxx, DDlS
–––––
Oxford, Dezember 1962
Liebe Kitty,
letzte Woche ist was Lustiges passiert, das muss ich Dir erzählen. Ich war auf dem Cornmarket und hab in meiner Tasche nach einem Handschuh gekramt (ja, ich weiß, hier trägt niemand Handschuhe, aber ich kann es mir nicht abgewöhnen, noch nicht), als plötzlich ein Wagen neben mir hielt. Auf der Beifahrerseite sprang ganz konfus ein älterer Mann in einem Mantel heraus, ein Klemmbrett in der einen Hand, eine Aktentasche in der anderen und den Hut in der dritten, wenn er eine gehabt hätte. Und dann taumelte auf der Fahrerseite ein schlaksiger junger Mann in Hemdsärmeln und einem schicken Pullunder mit Fair-Isle-Muster heraus. Er sah schrecklich aus, ganz grün und bleich und an den Rändern ausgefranst wie Wirsing. Er streckte die Hand aus, um sich von dem Mann mit dem Klemmbrett zu verabschieden, und im nächsten Moment schoss aus seinem Mund ein dicker Strahl Kotze, voll auf den Mann mit dem Klemmbrett. Kleine Karottenstückchen rutschten an seinem Mantel herunter und tropften auf die Schuhe.
Ich bot ihm mein Taschentuch an und versuchte, etwas von dem Zeug abzuwischen, aber eigentlich hätte man einen Gartenschlauch gebraucht. Der Wirsingmann starrte uns an und ging wortlos weg. Der arme Klemmbrettmann wischte seine Hutkrempe ab, und ich schüttelte das Taschentuch aus und sagte, viel mehr könnte ich wohl nicht für ihn tun. Der Klemmbrettmann sagte: „Ich hätte nicht gedacht, dass ihn das so mitnehmen würde.“ „Was denn?“, fragte ich. „Das war seine Prüfungsfahrt für den Führerschein, und er hat es sehr gut gemacht. Ich wollte ihm gerade sagen, dass er bestanden hat, als vor uns ein Hund auf die Straße lief. Er ist nicht in Panik geraten und hat das Lenkrad verrissen, aber er hat auch nicht gebremst – er hat das arme Tier einfach überfahren.“
Ich sah mir den Wagen an, und es stimmte: Die ganze Seite war irgendwie hundeartig verschmiert, und am Rückspiegel war ein Blutspritzer.
xxx, DDlS
P. S.: Mit „lustig“ meinte ich nicht den toten Hund, sondern die Kotze.









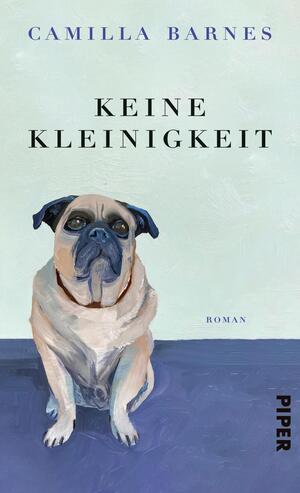
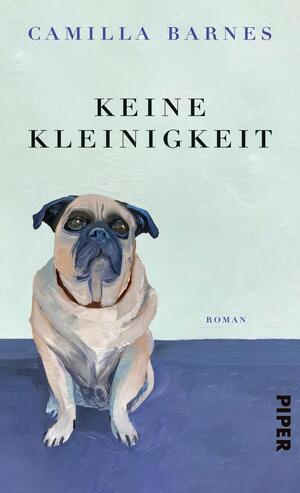



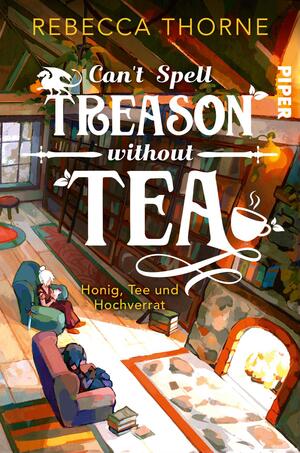
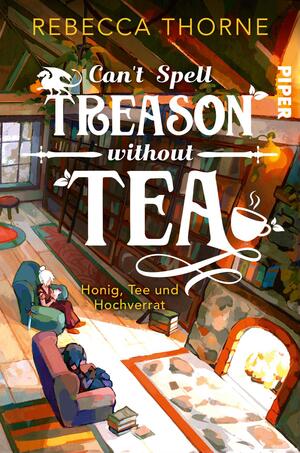

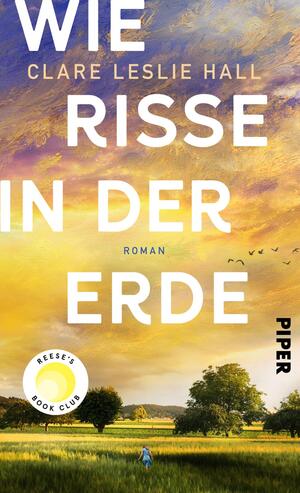











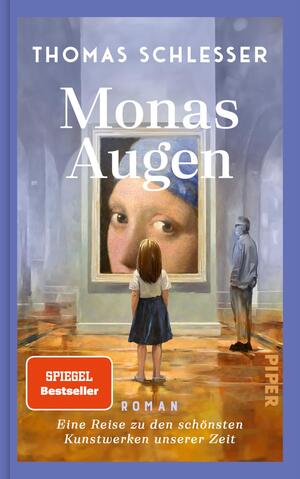



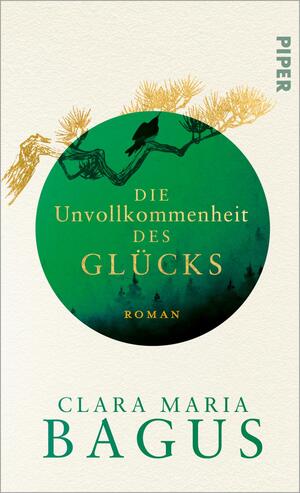












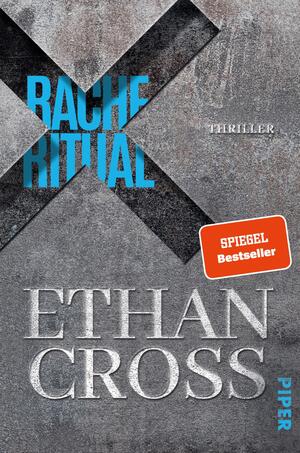
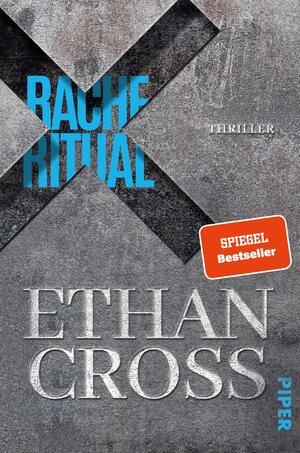





Kommentare
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.