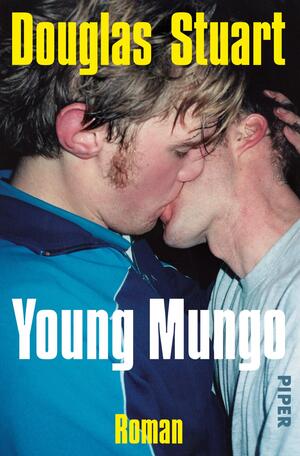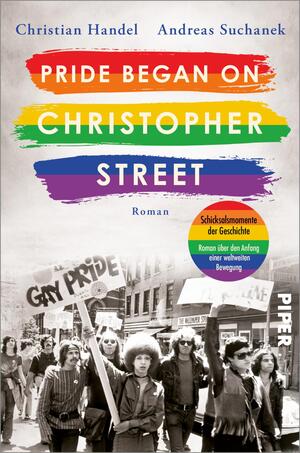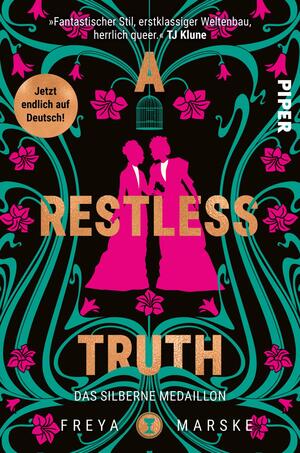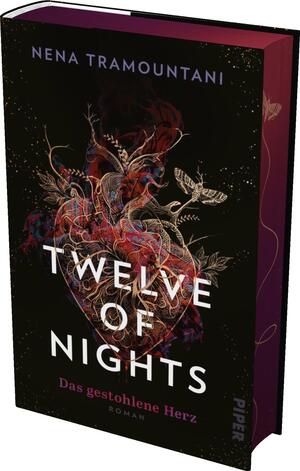LGBTQ+-Bücher und queere Literatur machen sichtbar, was lange unsichtbar war: queere Liebe, queere Familien, queere Lebensrealitäten. Auf dieser Seite gibt es eine sorgfältige Auswahl an LGBTQ-Büchern, queeren Romanen, Gay Romance und queeren Sachbüchern – für den Pride Month und für jeden anderen Tag im Jahr.
Ob Coming-of-Age-Geschichte, queere Liebeskomödie, historische Erzählung rund um den Christopher Street Day oder reflektierendes Sachbuch zu Identität und Geschlecht: Unsere queeren Bücher zeigen, wie vielfältig Liebe und Leben sein können.
3 Gründe, warum „Young Mungo" dich nicht mehr loslässt
- Ein authentischer Blick auf das Aufwachsen als queerer Junge im Glasgow der 1990er-Jahre.
- Preisgekrönte literarische Qualität – Nach dem Booker-Prize-Gewinn für Shuggie Bain verwandelt Stuart erneut komplexe Lebensrealität in fesselnde Literatur.
- Von Campino empfohlen – „Stuart weiß, wovon er erzählt. Hundertprozent realistisch."
Was den Roman von Res Sigusch so lesenswert macht:
- Angst als Zeitdiagnose:Katastrophenfantasien, Panikattacken, Doomscrolling – und die Frage, wie man echte von eingebildeten Bedrohungen trennt.
-Ein queerer Protagonist in einer sächsischen Kleinstadt – Klimakrise, Rechtsruck und rechte Bedrohung inklusive. Nah an der Realität, weit weg von Berlin-Blase.
- Res Sigusch schreibt als junge, queere Stimme aus genau der ostdeutschen Realität, über die sonst meist nur von außen gesprochen wird.
Darum gehört Written in the Stars auf deine Leseliste:
- Perfekt für alle, die queere Romance mit Humor und Herz suchen.
- Fake-Dating-Trope perfekt umgesetzt – Was als vorgetäuschte Beziehung beginnt, entwickelt sich zu einer Geschichte über Verletzlichkeit und echte Verbindung.
- Von Christina Lauren gefeiert – „Ich war von der ersten Seite an gefesselt!"
Ein historischer Roman über die Anfänge der Pride-Bewegung und darüber, was es heißt, trotz Repression zu sich selbst zu stehen.
Darum lohnt sich Pride began on Christopher Street:
- Erzählt die Vorgeschichte des Christopher Street Day als packende Liebesgeschichte.
- Von queeren Autoren für alle geschrieben – Christian Handel und Andreas Suchanek haben intensiv recherchiert und ihre eigene Geschichte mit historischen Fakten verwoben.
- Für alle, die mehr über die Wurzeln von Pride erfahren möchten – ohne ein Sachbuch lesen zu müssen.
Warum man Stolen Kisses gelesen haben sollte:
- LGBTQ-Fokus – Stolen Kisses ist ein LGBTQ-Buch, das sich auf die Darstellung von Gay Romance konzentriert. Perfekt für alle, die nach LGBTQ-Romanen und deutscher Gay-Romance suchen!
- Schwule Charaktere – Die Hauptfiguren in Stolen Kisses sind schwul, was zur Vielfalt und Inklusivität in Romanen beiträgt!
- Authentisch – Andreas Suchanek verleiht seinem New Adult-Roman mit Own-Voice-Elementen viel Echtheit!
„Liebe ist für mich wie ein Farbspektrum. Ich kann auf viele verschiedene Arten Liebe empfinden und diesem Gefühl diverse Bedeutungen zuschreiben – ohne, dass diese in Konkurrenz zueinanderstehen.“
Was Lieben und lieben lassen so besonders macht:
- Ein Sachbuch über Liebe als Spektrum, über Beziehungen jenseits fester Schubladen und über Identität in einer Welt voller Erwartungen.
- Ideal für alle, die mehr über Polyamorie, Queerness und Beziehungsmodelle wissen wollen.
- Persönliche Perspektive statt trockener Theorie – nahbar, reflektiert, offen.
Darum lohnt sich A Restless Truth:
- Mystery, Fantasy und Romance in perfekter Mischung.
- Historisches Setting mit modernem Twist – Viktorianische Ästhetik trifft queere Selbstverständlichkeit.
3 Gründe, in die Welt von Twelve of Nights einzutauchen:
- Griechische Legenden neu erzählt – Die Raunächte, uralte Rituale und Dämonen: Mythos trifft Moderne.
- Mit wunderschönem Farbschnitt
- Band 1 einer vielversprechenden Reihe – Der perfekte Einstieg in eine Welt voller Geheimnisse.
Darum lohnt sich Sind Penisse real?:
- Bietet eine trans Perspektive auf Körper, Geschlecht und Begehren.
- Ehrlich, verletzlich, reflektiert – kein „Erklärbuch“, sondern gelebte Erfahrung.
- Für alle, die ihr Verständnis von Geschlecht erweitern oder eigene Erfahrungen gespiegelt sehen wollen.
Warum Even the Stars Dream dein nächstes Herzensbuch wird:
- Verbindet Gay Romance mit K-Pop, Social Media und öffentlichem Leben.
- Erzählt von mentaler Gesundheit, Druck und der Frage: Was ist mir wirklich wichtig?
- Für alle, die queere New-Adult-Bücher mit Popkultur-Touch lieben.
Pride Month, CSD und Stonewall – warum das heute noch wichtig ist
Der Juni gilt weltweit als Pride Month. In vielen Städten finden Christopher-Street-Day-Demonstrationen (CSDs) statt, auf denen queere Menschen und Allies für Sichtbarkeit, Sicherheit und gleiche Rechte auf die Straße gehen.
LGBTQ+-Bücher tragen dazu bei, diese Themen auch im Alltag präsent zu halten:
- Sie machen queere Lebensrealitäten sichtbar.
- Sie geben queeren Leser:innen Identifikationsfiguren.
- Sie ermöglichen nicht-queeren Leser:innen, Vorurteile zu hinterfragen.

Warum gibt’s eigentlich Christopher Street Days und den Pride Month?
Der Juni gilt als Pride Month: Es ist die Zeit der Regenbogenflaggen, der überdurchschnittlich vielen Berichte über queere Themen – und die Zeit der Christopher Street Days. Weltweit versammeln sich auf ihnen Millionen von Menschen, um für ihre Rechte zu demonstrieren, queeres Leben sichtbar zu machen und füreinander einzustehen.
Aber wie kam es eigentlich zum ersten CSD? Was hatte eine von der Mafia geführte Schwulenbar in New York City damit zu tun? Und weshalb gilt der Sommer 1969 als Wendepunkt im Kampf für die Gleichstellung und Anerkennung queerer Menschen?
Diesen Fragen sind Christian Handel und Andreas Suchanek in ihrem gemeinsamem historischen Roman PRIDE BEGAN ON CHRISTOPHER STREET (Piper Verlag) nachgegangen, der im Mai 2024 erschienen ist.
Jake und Finn, die beiden Protagonisten des Romans von Handel und Suchanek, stehen auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes. Dennoch rettet der Polizist Jake Finn vor einem brutalen Polizeiübergriff - denn Jake ist selbst schwul, ohne es sich einzugestehen. Zwischen ihnen funkt es sofort. Obwohl sie in ihren Vorurteilen über den anderen gefangen sind, nähern sie sich an. Als sich in der Nacht auf den 28. Juni 1969 im Stonewall Inn in der Christopher Street die Barbesucher erstmals vehement gegen die Polizei wehren, müssen sich die beiden entscheiden, auf welcher Seite sie stehen.
Der 28. Juni 1969 wird im Roman für Jake und Finn zum Schicksalsmoment ihrer Liebe – und in der Realität schrieb dieser Tag Geschichte: Der Stonewall-Aufstand in der Christopher Street wurden zum Wendepunkt der LGBTQIA⁺-Bewegung im Kampf um Gleichbehandlung und Anerkennung.
„Einen Unterhaltungsroman über die Entstehung der Christopher Street Days gab es bisher in Deutschland unseres Wissens noch nicht“, verrät das Autoren-Duo auf die Frage, weshalb sie diese Geschichte unbedingt schreiben wollten. Beide Autoren sind schwul. „Die Ereignisse rund um das Stonewall Inn im Sommer 1969 sind ein wichtiger Teil der Geschichte unserer Community und deshalb haben wir uns mit Feuereifer auf dieses Romanprojekt gestürzt. Denn was damals passiert ist und mit welchen Ungerechtigkeiten sich queere Menschen in dieser Zeit herumschlagen mussten, wissen viele heute gar nicht. Wir hoffen, dass unser Roman ein bisschen dabei hilft, das zu ändern.“
Während der Recherche haben sie nicht nur Sachtexte gelesen und Dokumentationen gesehen, sondern sich auch mit Essays und Zeitzeugen-Interviews beschäftigt. „Das war hart“, sagen sie. „Wir haben uns zwar bereits zuvor mit dem Thema ausgekannt, diesmal sind wir aber über viele sehr persönliche Geschichten und Einzelschicksale gestolpert, die uns extrem berührt haben.“ Und so ist auch die berührende Geschichte von Jake und Finn entstanden, fiktive Figuren, die im Verlauf des Romans aber auch historischen Persönlichkeiten begegnen.
Schon ein Jahr nach dem Stonewall Aufstand wurde in New York dieses Ereignis mit einem Gedenkmarsch gewürdigt. Und seitdem finden weltweit Christopher Street Days statt. Diese sind bis heute noch nötig: Der Lesben- und Schwulenverband LSVD berichtet auf seiner Website, dass gleichgeschlechtliche Sexualität noch immer in 66 Ländern strafrechtlich verfolgt wird, in 12 davon steht sie sogar unter Todesstrafe. Das FBI sah sich jüngst genötigt, vor Terroranschlägen auf CSDs zu warnen. Und auch hierzulande nimmt die gemeldete Anzahl an Fällen homophober Hasskriminalität seit Jahren zu. „Christopher Street Days sind wichtig“, sagt Handel. „Auch, weil queere Menschen und Allys dann zusammenkommen können und feststellen, wie viele sie sind, dass sie nicht allein sind.“
Wer selbst diesen Sommer einen Christopher Street Day besuchen möchte, findet alle Termine auf www.csd-termine.de.
LGBTQ+-Bücher stellen lesbische, schwule, bisexuelle, trans, queere und andere nicht-heteronormative Identitäten in den Mittelpunkt – in Form von Romanen, Jugendbüchern oder Sachbüchern.
Für einen leichten Einstieg eignen sich RomComs wie Written in the Stars oder New-Adult-Titel wie Stolen Kisses.