Produktbilder zum Buch
Wovon wir träumen
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Nur eins kann ich mir nicht aussuchen: Tochter sein
Eine junge Frau steht auf einem Berg in Shaoxing. Sie ist gekommen, um ihre Großmutter zu beerdigen. Die Frage, wo sie selbst hingehört, schiebt sie beiseite. Vielleicht ist sie überall ein bisschen zu Hause oder nirgendwo ganz. Ihre Mutter hat China vor Jahren verlassen, weil sie in Deutschland ein anderes Leben wollte. Die Träume der jungen Frau ähneln denen ihrer Mutter. Und doch träumt sie anders, weil die Orte verschwimmen und sie die Geister der Familie nicht loswird.
Subtil, mutig und mit feinem Gefühl für die Sprache erzählt Lin Hierse…
Nur eins kann ich mir nicht aussuchen: Tochter sein
Eine junge Frau steht auf einem Berg in Shaoxing. Sie ist gekommen, um ihre Großmutter zu beerdigen. Die Frage, wo sie selbst hingehört, schiebt sie beiseite. Vielleicht ist sie überall ein bisschen zu Hause oder nirgendwo ganz. Ihre Mutter hat China vor Jahren verlassen, weil sie in Deutschland ein anderes Leben wollte. Die Träume der jungen Frau ähneln denen ihrer Mutter. Und doch träumt sie anders, weil die Orte verschwimmen und sie die Geister der Familie nicht loswird.
Subtil, mutig und mit feinem Gefühl für die Sprache erzählt Lin Hierse in „Wovon wir träumen“ von einer Beziehung zwischen Mutter und Tochter und den Fragen nach Identität, Nähe und Abgrenzung. Auf den Spuren der deutsch-chinesischen Geschichte findet sie eine Form, Migration nicht als Trauma zu begreifen, sondern als Traum.
„Extrem berührend und unaufdringlich nah: ein Roman wie eine innige Umarmung.“ Fatma Aydemir
Über Lin Hierse
Aus „Wovon wir träumen“
abschied
Der Tag, an dem wir A’bu nach Hause bringen, ist sehr gewöhnlich. Es ist frühmorgens an irgendeinem Dienstag im April, der Himmel über Shanghai ist weder grau noch blau, es regnet nicht und es scheint auch nicht die Sonne. Es ist einfach, wie es ist.
Da Jiujiu, mein ältester Onkel, steht auf dem Bürgersteig und hält ein großes gerahmtes Portraitfoto von A’bu in den Händen. Es ist in dicken schwarzen Stoff eingewickelt, nur oben links, wo das Tuch verrutscht ist, schaut ihre ordentliche Frisur hervor. Da Jiujiu sieht müde aus und sanft. Er war immer schon der [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Im Mittelpunkt deines Buches steht die Erzählerin und ihre Beziehung zu ihrer Mutter. Warum ist das Tochtersein so besonders für diese junge Frau?
Ich denke, Tochtersein ist für alle Frauen eine sehr prägende und intime Erfahrung. Die Erzählerin in meinem Buch ist die Einzige, die annähernd verstehen kann und will, wer ihre Mutter ist und wer sie vor ihrer Einwanderung von China nach Deutschland war. Sie versucht, die Rolle der engsten Vertrauten zu erfüllen, zu der ihre Mutter jederzeit sagen könnte „Du weißt ja, wie das ist“. Natürlich klappt das nicht immer.
Während ihre Mutter sich bewusst entschieden hat, China zu verlassen, muss sich die Erzählerin, die in Deutschland geboren ist, immer wieder mit der Frage nach der Zugehörigkeit auseinandersetzen. Ist das schmerzlich für sie?
Schmerzlich ist für sie sicher die Erfahrung, dass ihre Position – als Person „zwischen den Kulturen“, wie es oft heißt – ständig von anderen erzählt wird. Auch was die Frage nach Zugehörigkeit betrifft: Du gehörst ein bisschen hierher und ein bisschen nach da, aber eigentlich bist du immer im Zwischenraum. Sie übernimmt diese Vorstellung einer dauernden Unvollständigkeit auf eine Art sogar selbst, aus Mangel an Alternativen. Aber das reicht ihr nicht. Sie will ganz sein.
Der Titel spricht vom Träumen. Was hat es damit auf sich?
Träume spielen auf mehreren Ebenen eine Rolle für das Buch. Die Erzählerin steht über ihre Träume in Verbindung mit verstorbenen Familienmitgliedern. Deren Geister besuchen sie in ihren Träumen. Außerdem verschwimmen die Erinnerungen ihrer Mutter an das Leben in China auf eine traumähnliche Art. Je weiter es in die Vergangenheit rückt, desto schwerer fällt es ihr, die damaligen Umstände wiederzugeben. Die Erzählerin versucht, diese Geschichten zu retten. Und letztendlich geht es auch um Träume im Sinn von Lebensträumen. Was wünschen wir uns vom Leben

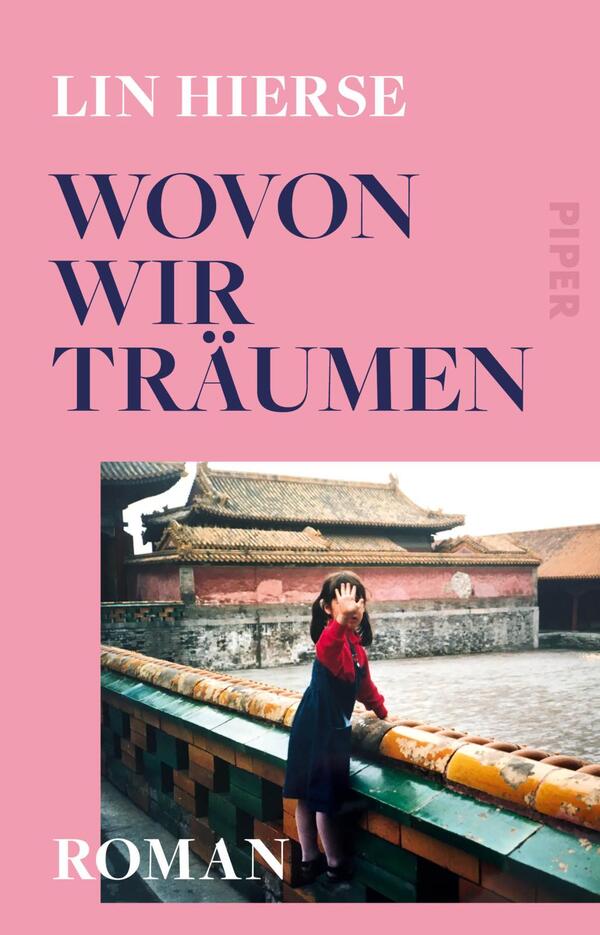
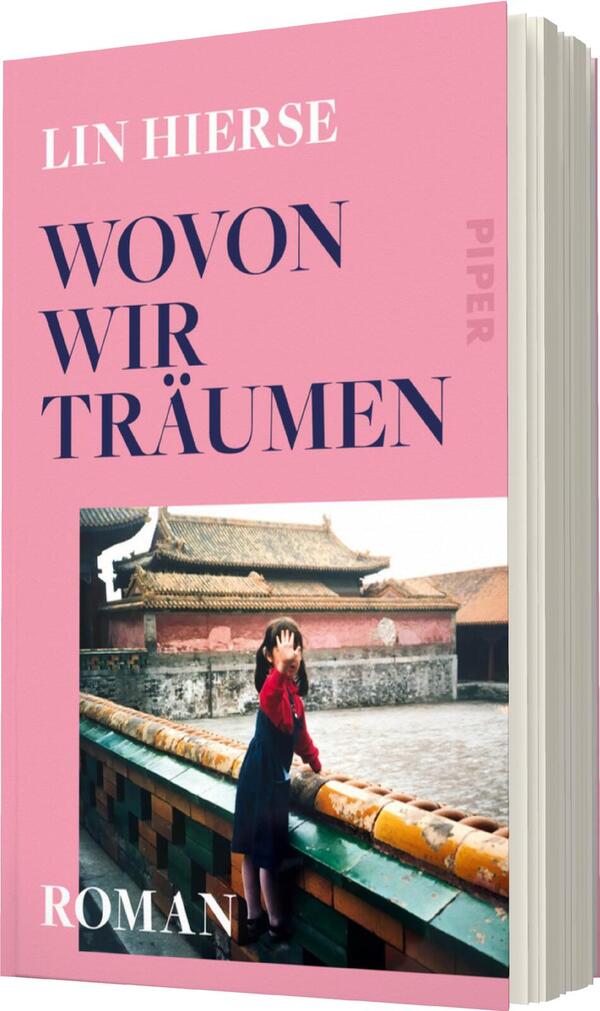



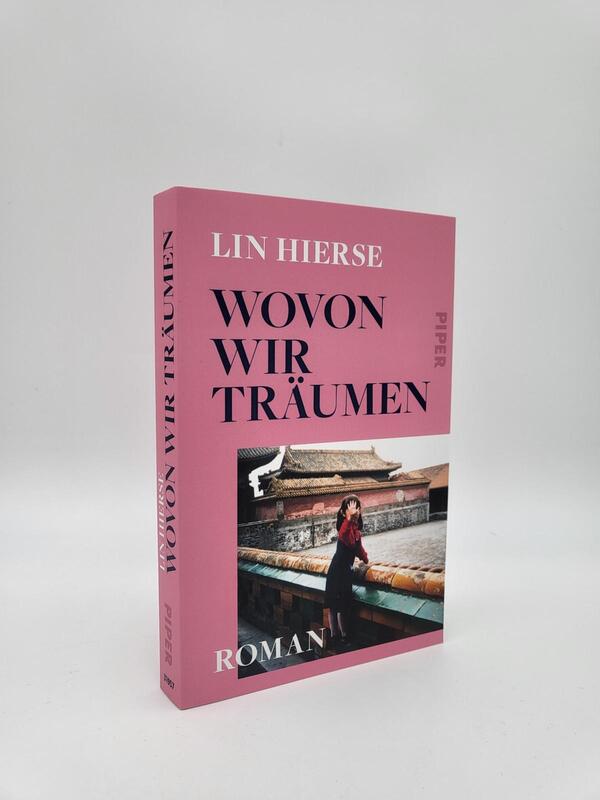














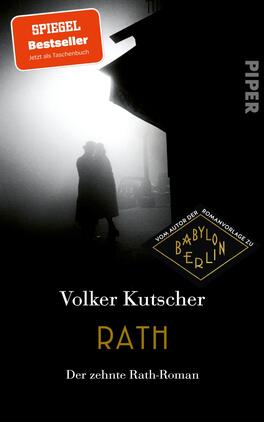
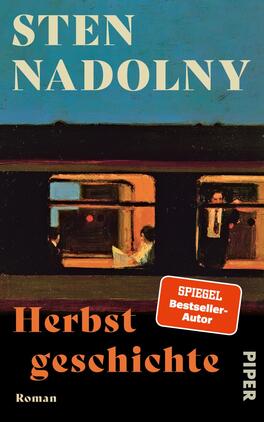


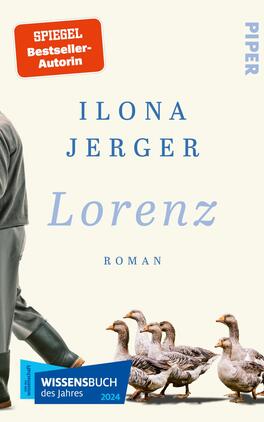



Bewertungen
Ich finde das Buch sehr eindrucksvoll, weil es viele Situation darstellt, die ich auch immer wieder erlebt und empfunden. Als Mann, Jahrgang 1950, geboren in Beijing mit chinesischer Mutter und deutschem Vater, aufgewachsen dann in einer deutschen Großstadt und späteren mehrfachen China Aufenthalten…
Ich finde das Buch sehr eindrucksvoll, weil es viele Situation darstellt, die ich auch immer wieder erlebt und empfunden. Als Mann, Jahrgang 1950, geboren in Beijing mit chinesischer Mutter und deutschem Vater, aufgewachsen dann in einer deutschen Großstadt und späteren mehrfachen China Aufenthalten . Das war anderes, als was Lin Hierse von der Protagonisten schreibt aber hinsichtlich der Beziehung zu China vieles sehr ähnlich. Sie beschränkt sich in ihrem Roman auf das Verhältnis Tochter und Mutter. Gern hätte ich gewusst, welche Rolle denn der Vater als "Deutscher" in der ganzen Entwicklung gespielt hat und welche Beziehung denn die Eltern zueinander hatten und wie sich die auf die Protagonistin auswirken? Vielleicht schreibt Frau Hierse über diese andere Hälfte der Erfahrungswelt der Protagonistin ja demnächst einen weiteren Roman.
Wovon wir träumen
Ein wunderbares Buch.Lin Hierse nimmt uns an der Hand und wir sind direkt dabei,ìn dieser Geschichte. Ich möchte nicht das dieses Buch schnell endet. Hoffe sie schreibt noch viele Bücher. Danke
Joachim Tarwitt Berlin 22. August 2023