Ausgezeichnete Übersetzungen
Wir freuen uns über folgende Preise für unsere Übersetzer*innen.
weitere Infos
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Krueger fängt in diesem besonderen Coming of Age Roman die Stimmung der 60er Jahre in Nirgendwo von Amerika und die noch relativ unberührte Landschaft authentisch ein.“
Wochenanzeiger AltmühltalVon der Freude und Traurigkeit des Erwachsenwerdens, vom Ende der Unschuld und von der Kraft der Anteilnahme
Im Sommer des Jahres 1961 kommt der Tod in vielen Formen nach New Bremen. Als Unfall. Als Selbstmord. Und als Mord. Zusammen mit seinem kleinen Bruder Jake scheint der dreizehnjährige Frank immer am falschen Ort zu sein – oder am richtigen, schließlich liefert eine Leiche auch Stoff für gute Geschichten. Bis das Sterben auch Franks Familie heimsucht. Plötzlich tut sich vor den Brüdern die ganze Welt der Erwachsenen auf, und der Tod fordert von allen eine Entscheidung: für die Familie,…
Von der Freude und Traurigkeit des Erwachsenwerdens, vom Ende der Unschuld und von der Kraft der Anteilnahme
Im Sommer des Jahres 1961 kommt der Tod in vielen Formen nach New Bremen. Als Unfall. Als Selbstmord. Und als Mord. Zusammen mit seinem kleinen Bruder Jake scheint der dreizehnjährige Frank immer am falschen Ort zu sein – oder am richtigen, schließlich liefert eine Leiche auch Stoff für gute Geschichten. Bis das Sterben auch Franks Familie heimsucht. Plötzlich tut sich vor den Brüdern die ganze Welt der Erwachsenen auf, und der Tod fordert von allen eine Entscheidung: für die Familie, die Freunde und das Leben.
„Ein wundervoller Erzählton. Ich liebe dieses Buch.“ Dennis Lehane
Prolog
Das große Sterben des damaligen Sommers begann mit dem Tod eines Kindes, eines Jungen mit goldblondem Haar und einer dicken Brille, der auf der Bahnstrecke kurz hinter New Bremen in Minnesota ums Leben kam, zermalmt von tausend Tonnen Stahl, die über die Prärie Richtung South Dakota donnerten. Er hieß Bobby Cole. Er war ein liebenswertes Kind, und damit meine ich vor allem, dass sein Blick immer verträumt wirkte und ein halbes Lächeln auf seinen Lippen lag, als würde er gleich etwas begreifen, das man ihm schon seit Stunden zu erklären versuchte. Ich hätte [...]
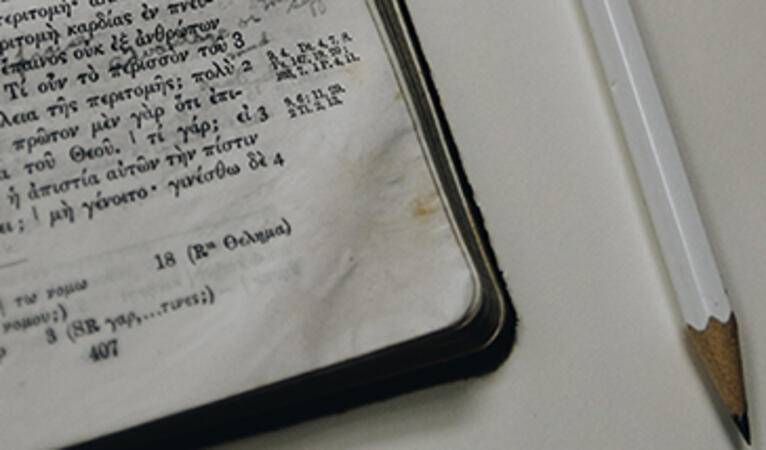
Wir freuen uns über folgende Preise für unsere Übersetzer*innen.
weitere Infos„William Kent Krueger (schreibt) auf wundersame Weise so, dass der Leser in jedem Augenblick berührt, sein Herz angetippt wird und er so tief Anteil nimmt.“
Wilhelmshavener Zeitung„Wie Krueger die Handlungsfäden verknüpft und immer dichter werden lässt, ist bestes Erzählerhandwerk. Das Buch ist kein Krimi, aber trotzdem so spannend, dass man es kaum aus der Hand legen mag.“
Evangelische Zeitung Hamburg„Der Roman lebt von seiner Kulisse und seinem Erzählton …“
Doppelpunkt - Magazin für Kultur in Nürnberg - Fürth - Erlangen„Ein Roman, in dem man sich gleich ganz zu Hause fühlt, durchpulst ist von einem Gefühl der Nostalgie und Vergänglichkeit.“
Aachener Zeitung„Krueger fängt in diesem besonderen Coming of Age Roman die Stimmung der 60er Jahre in Nirgendwo von Amerika und die noch relativ unberührte Landschaft authentisch ein.“
Wochenanzeiger Altmühltal
Die erste Bewertung schreiben