Produktbilder zum Buch
Als der Sturm kam (Schicksalsmomente der Geschichte 2)
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„"Als der Sturm kam" zeichnet ein realistisches Bild der Sturmflut von 1962 in Hamburg. Mit Entsetzen habe ich gelesen, wozu die Natur fähig ist. Gut gefallen hat mir dabei, dass die Autorin auch einige rührende Momente eingebaut hat. Von mir gibt es eine Leseempfehlung.“
buchwurm05Beschreibung
„Als der Sturm kam“ | Die Hamburger Sturmflut von 1962
Deiche brechen im Minutentakt, Straßen werden zu reißenden Flüssen, Menschen sind vom Wasser eingeschlossen. Es ist die Stunde der Wahrheit.
Für die spannende Reihe „Schicksalsmomente der Geschichte“ erzählt Anja Marschall in ihrem historischen Roman von Hamburgs dramatischsten Stunden seit dem Zweiten Weltkrieg:
Als die Flutkatastrophe über Hamburg hereinbricht, wird die Schreibkraft Marion der Leitung von Polizeisenator Helmut Schmidt unterstellt. Ein Krisenstab muss eingerichtet, NATO-Verbündete um Hilfe gebeten, Hubschraubereinsätze…
„Als der Sturm kam“ | Die Hamburger Sturmflut von 1962
Deiche brechen im Minutentakt, Straßen werden zu reißenden Flüssen, Menschen sind vom Wasser eingeschlossen. Es ist die Stunde der Wahrheit.
Für die spannende Reihe „Schicksalsmomente der Geschichte“ erzählt Anja Marschall in ihrem historischen Roman von Hamburgs dramatischsten Stunden seit dem Zweiten Weltkrieg:
Als die Flutkatastrophe über Hamburg hereinbricht, wird die Schreibkraft Marion der Leitung von Polizeisenator Helmut Schmidt unterstellt. Ein Krisenstab muss eingerichtet, NATO-Verbündete um Hilfe gebeten, Hubschraubereinsätze geplant werden. Marion kämpft gegen Müdigkeit und hat Angst um ihre bettlägerige Mutter, die mitten im überfluteten Gebiet von Wilhelmsburg in einer Gartenkolonie wohnt. Zur gleichen Zeit versucht der Hubschrauberpilot Hermann unter Einsatz seines Lebens, die Menschen von den Dächern ihrer Häuser zu retten. Die Nacht ist eiskalt, und das Wasser steigt noch immer …
100.000 vom Wasser eingeschlossene Menschen, 15.000 Helfer, 315 Tote: Die Hamburger Sturmflut von 1962 war für die Hansestadt die größte Katastrophe der Nachkriegszeit.
Im Februar 1962 wütet an der Nordseeküste ein Orkan. Gefühlt weit weg für die Hamburger, die sich in Sicherheit wähnen. Doch der Sturm ist längst auf dem Weg und überrascht die Menschen im Schlaf. Kurz nach Mitternacht brechen in Minutenfolge die Deiche, die Hamburg schützen sollen. Straßen werden zu reißenden Flüssen, in der gesamten Stadt fällt der Strom aus. Helmut Schmidt, damals Polizeisenator in Hamburg, beginnt noch in der Nacht, die Rettungsaktionen zu koordinieren.
Exzellent recherchiert und packend erzählt: Anja Marschall schildert in ihrem bewegendem Roman die Geschichte der Menschen, die in den Stunden der Sturmflut um ihr Leben kämpfen.
Anja Marschall kam im Jahr der Sturmflut in Hamburg zur Welt. Dort arbeitete sie vor ihrer schriftstellerischen Karriere u.a. als Lokaljournalistin und Pressereferentin. Bei Piper erschien zuletzt ihre Erfolgsserie „Töchter der Speicherstadt“.
Weitere Titel der Serie „Schicksalsmomente der Geschichte“
Über Anja Marschall
Events zum Buch
Anja Marschall liest aus „Als der Sturm kam“ in Oldendorf
Anja Marschall liest aus „Als der Sturm kam“ in Hamburg
Aus „Als der Sturm kam (Schicksalsmomente der Geschichte 2)“
Vorwort
Dieser Roman hat die schwere Aufgabe, Ihnen die katastrophale Sturmflut vom 16. auf den 17. Februar 1962 in Hamburg näherzubringen. Er will erklären, beleuchten und schildern, zu welch übermenschlichen Taten ein jeder fähig ist, wenn er um sich und seine Lieben fürchten muss. Die folgenden Seiten sollen aber auch zeigen, dass der Mensch manchmal ein weitaus besseres Wesen ist, als er von sich selbst denkt.
So akribisch wie möglich habe ich die Katastrophe aufgearbeitet, die damals über die Stadt hereinbrach. Die Zeiten im Text musste ich gelegentlich an die [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Sie schreibt anschaulich und in aussagekräftigen Bildern über die entfesselten Naturgewaltenstellt dramatische Situationen dar, die unter die Haut gehen.“
Freie Presse„"Als der Sturm kam" zeichnet ein realistisches Bild der Sturmflut von 1962 in Hamburg. Mit Entsetzen habe ich gelesen, wozu die Natur fähig ist. Gut gefallen hat mir dabei, dass die Autorin auch einige rührende Momente eingebaut hat. Von mir gibt es eine Leseempfehlung.“
buchwurm05
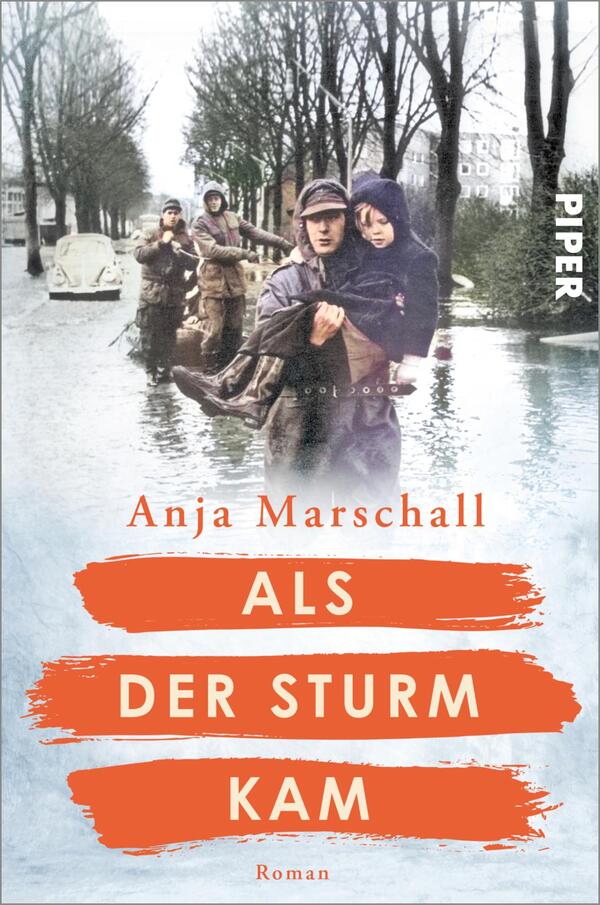
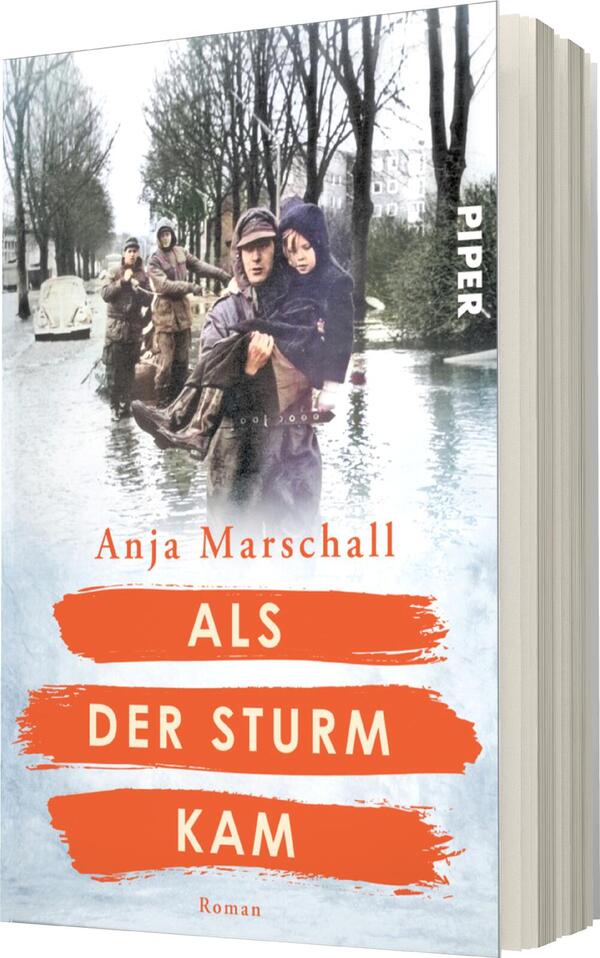
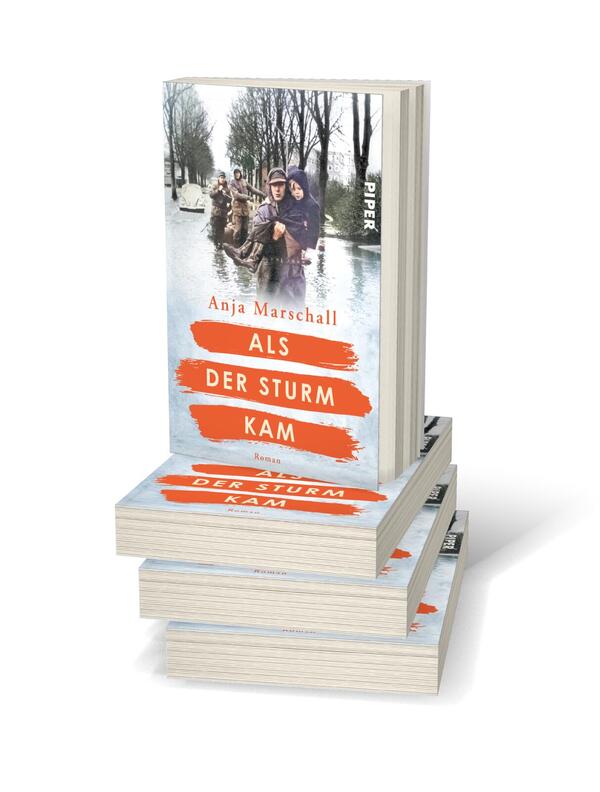










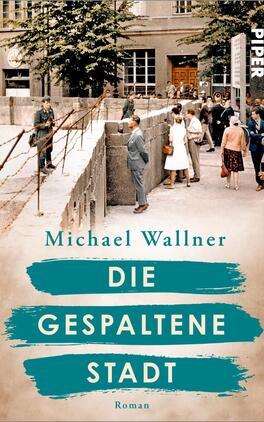


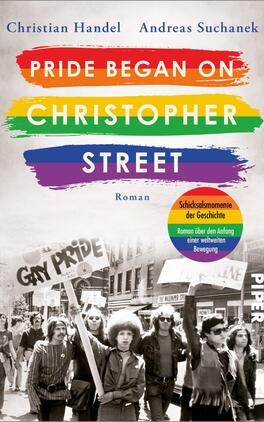
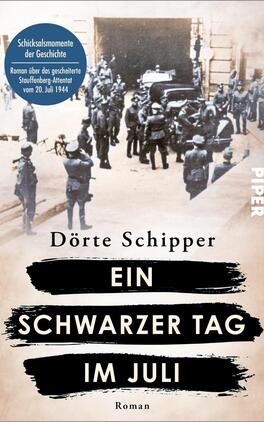









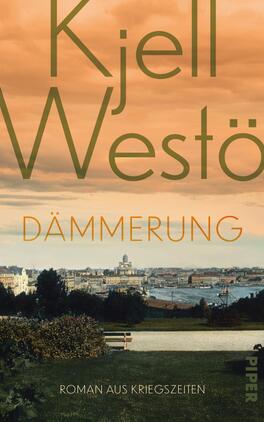
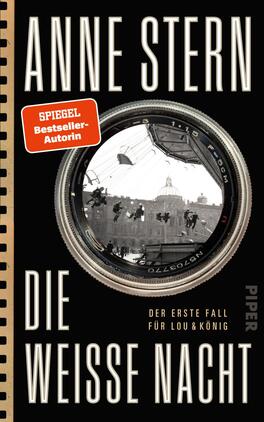


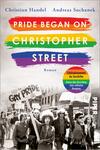

Bewertungen
Gratwanderung der Gefühle
Ich stelle es mir schwierig vor, einen Roman über eine derartige Katastrophe zu schreiben, die dennoch unterhält. Der Autorin ist das hervorragend gelungen. Man lernt - wie immer in den Büchern der Marschall - eine Menge und begegnet markanten Figuren, die in Erinnerung bleiben. Hier werden histr…
Ich stelle es mir schwierig vor, einen Roman über eine derartige Katastrophe zu schreiben, die dennoch unterhält. Der Autorin ist das hervorragend gelungen. Man lernt - wie immer in den Büchern der Marschall - eine Menge und begegnet markanten Figuren, die in Erinnerung bleiben. Hier werden histroische Persönlichkeiten und fiktive perfekt miteinander gemischt. Die Tatsachen sind super recherchiert. Die Stunden der Flut unglaublich lebendig.
Geschichte wird lebendig!
Eine auf Tatsachen beruhende, genial konstruierte, ans Herz gehende Geschichte! Fesselnd, berührend, Mut machend! So wird Geschichte lebendig! Der Sturm kam…und hat mich mitgerissen!
Diesen ergreifenden Roman und seine vielen kleinen Erzählungen aus verschiedenen, sich stetig abwechselnde…
Eine auf Tatsachen beruhende, genial konstruierte, ans Herz gehende Geschichte! Fesselnd, berührend, Mut machend! So wird Geschichte lebendig! Der Sturm kam…und hat mich mitgerissen!
Diesen ergreifenden Roman und seine vielen kleinen Erzählungen aus verschiedenen, sich stetig abwechselnden Perspektiven mit den tatsächlichen Ereignissen in Hamburg im Februar 1962 so zu verflechten, dass man das Gefühl bekommt, alles sei genau so geschehen, wie die Autorin es beschreibt, verlangt mir wirklich allerhöchsten Respekt ab.
Ich ziehe den Hut vor der in ihrer Intensität kaum greifbaren Rechercheleistung der Autorin und der Verknüpfung all der recherchierten Fakten mit dieser, ihrer(!) Geschichte „Als der Sturm kam“!
Unwetter wird immer unser Leben bestimmen und verändern
"Der Strahl der Lampe erfasste ein Häuschen, auf dem eine Familie mit Kindern kauerte" (Buchauszug)
Im Polizeihaus ist Schreibkraft Marion Klinger während der Sturmflut dem Polizeisenator Helmut Schmidt unterstellt. Sie versucht in ihren schwersten Stunden, die Sorge um ihre Mutter zu ver…
"Der Strahl der Lampe erfasste ein Häuschen, auf dem eine Familie mit Kindern kauerte" (Buchauszug)
Im Polizeihaus ist Schreibkraft Marion Klinger während der Sturmflut dem Polizeisenator Helmut Schmidt unterstellt. Sie versucht in ihren schwersten Stunden, die Sorge um ihre Mutter zu vergessen zum Wohl der Hamburger Bevölkerung. Hubschrauberpilot Georg Hagemann, dessen Traum ist, einmal die Starfight F-104 fliegen zu dürfen, ist in dieser Nacht ebenfalls im Einsatz. Trotz Einsatz seines Lebens versucht er möglichst viele Menschen aus den überschwemmten Gebieten zu retten. Während Dieter Krämer beim THW kräftig mit anpackt, ist er erleichtert, seine Familie in Sicherheit zu wissen. Er ahnt ja nicht, dass Klein-Uschi krank wurde und Marion mit den Kindern zurück in die Laubenkolonie gegangen ist. Ausgerechnet in die Region, die von Hochwasser am stärksten betroffen ist.
Meine Meinung:
Aus der Reihe "Schicksalsmomente der Geschichte" geht es im zweiten Band um die Hamburger Sturmflut. Als die Sturmflut mitten in der Nacht am 16. Februar 1962 über Hamburg hereinbricht, sind viele nicht darauf vorbereitet. Keiner rechnet damit, dass so viele Deiche brechen und ganze Regionen unter Wasser setzen würden. In jener Nacht werden 100 000 Menschen vom Wasser eingeschlossen und 1500 Helfer versuchen möglichste viele Menschen und Tiere zu retten. Ihnen und dem schnellen Eingreifen der vielen von damals wie z. B. Senator Helmut Schmidt ist es zu verdanken, dass nur 315 Menschen diese Sturmflut nicht überlebt haben. Für die Hamburgerin Anja Marschall ist dies sicher eines von vielen historischen Ereignisse Hamburgs. Ich kann ehrlich gesagt gut verstehen, warum sie es uns in diesem Buch näherbringen möchte. Zum besseren Verständnis erlebe ich private Schicksale von fiktiven Personen hautnah mit, die mir allesamt unter die Haut gehen. Dieses Erlebte basiert alles auf wahrem Hintergrund, nur die Namen wurden aus Respekt umbenannt. Außerdem erlebe ich viele reale Persönlichkeiten von damals wie z. B. Senator Helmut Schmidt, Bürgermeister Nevermann, Polizeioberrat Martin Leddin bei ihrem Einsatz zum Wohle der Menschen. Dass aus lauter Not in dieser Nacht viele Handlungen am Rand der Legalität stattfanden, hat mich extrem beeindruckt. Denn es zeigt mir, wie wichtig den Verantwortlichen die Menschen Hamburgs gewesen sind. Am schlimmsten betroffen ist Wilhelmsburg und die Laubenkolonie, die im Buch beschrieben werden, sie gab es wirklich. Ich spüre wieder einmal, wie sehr ich beim Lesen mit den Charakteren mitfiebere und leide. Die Geschehnisse von damals gehen mir ans Herz und ich vergieße bei einigen Szenen sogar regelrecht Tränen. Maßgebend dafür sind die emotionale Schreibweise und ihre gute Recherche der Autorin und Historikerin. Die hat nämlich wieder einmal ihr ganzes Herzblut in dieses Buch gesteckt. Deshalb liebe ich ihre historischen Bücher, weil sie so zeitnah und authentisch dargestellt sind. Damals konnten viele Menschen nicht vorgewarnt werden, den es gab kaum Telefone, geschweige den Handys. Allerdings, selbst in der heutigen modernen Zeit sind wir noch immer den Naturgewalten ausgeliefert. Das müssen wir vor allem im Juli 2021 im Ahrtal miterleben, wo viele vom Hochwasser überrascht werden und wieder 135 Menschen sterben. Die Reihe der Schicksalsmomente der Geschichte gehen weiter, doch für mich ist dieser Band überaus wertvoll. Ich kann ihn euch nur ans Herz legen und gebe 5 von 5 Sterne dafür.
Hamburgs Schicksalsnacht von 1962
Zum Inhalt:
16./17. Februar 1962. Marion Klinger wohnt in einer Laubenkolonie in Hamburg-Wilhelmsburg zusammen mit ihrer bettlägerigen Mutter. Der Sturm Vincinette hat sich angekündigt und da Marion nicht schlafen kann, kehrt sie um 23.00 Uhr ins Polizeihaus, in dem sie als Schreibkraft a…
Zum Inhalt:
16./17. Februar 1962. Marion Klinger wohnt in einer Laubenkolonie in Hamburg-Wilhelmsburg zusammen mit ihrer bettlägerigen Mutter. Der Sturm Vincinette hat sich angekündigt und da Marion nicht schlafen kann, kehrt sie um 23.00 Uhr ins Polizeihaus, in dem sie als Schreibkraft arbeitet, zurück. Während die Hamburger friedlich in ihren Betten schlummern, beginnen die Deiche zu brechen und eine Flutkatastrophe nimmt ihren Lauf. Während man zunächst unkoordiniert versucht, der Lage Herr zu werden, übernimmt der noch junge und neue Polizeisenator Helmut Schmidt die Koordination; da seine Sekretärin nicht da ist, besetzt Marion Klinger die Position, um ihn zu unterstützen. Bei all dem muss sie ihre eigenen Sorgen um ihre Mutter und ihre Nachbarn unterdrücken, denn ihr Zuhause liegt genau in dem Überschwemmungsgebiet.
100.000 vom Wasser eingeschlossene Menschen, 15.000 Helfer, 315 Tote: Die Hamburger Sturmflut von 1962 war für die Hansestadt die größte Katastrophe der Nachkriegszeit.
Meine Meinung:
Das Cover trifft das Zeitgeschehen gut. Mein Blick fiel deshalb auf dieses Buch, weil ich einmal eine Dokumentation darüber gesehen habe und ich war neugierig, wie die Autorin Anja Marschall diese Flutkatastrophe in ihrem Buch umsetzt. In kurzen Kapiteln, vermerkt mit Datum und Uhrzeit, konnte ich den Ablauf der Katastrophe verfolgen.
Historische Fakten, Ereignisse und Personen harmonierten wunderbar mit den fiktiven Protagonisten. Die sympathische Hauptfigur Marion meistert ihre neuen Aufgaben beeindruckend. Berührende Schicksale und Begebenheiten werden an fiktiven Personen anschaulich beschrieben, die man abwechselnd ein Stück begleitet und so einen realistischen Blick auf die verschiedenen Perspektiven erhält. Ich hatte regelrecht das Gefühl, mit diesen Figuren ums Überleben zu kämpfen, zu bangen und zu trauern, darüber hinaus bewunderte ich, wie Menschen in größter Not über sich selbst hinauswachsen. Viele vollbrachten Heldenhaftes, ohne an ihr eigenes Wohlergehen zu denken. Helmut Schmidts Rolle als Krisenmanager während der Sturmflut wurde authentisch, mit Originalzitaten, integriert und ich hatte geradezu Schmidts Stimme im Ohr, die ich aus Dokumentationen kannte.
Das Buch erinnert daran, wie schnell eine Katastrophe passieren kann und dies nicht nur 1962; das sieht man ja an dem Jahrhunderthochwasser im Ahrtal.
Fazit:
Bewegender und gut recherchierter, historischer Roman über die Flutkatastrophe in Hamburg.