Produktbilder zum Buch
Ärztin einer neuen Ära (Bedeutende Frauen, die die Welt verändern 8)
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Mitreißender Roman“
erlesen-MagazinBeschreibung
Vordenkerin, Medizinerin, Wegbereiterin
Berlin, 1898: Nach dem Abitur kann es Hermine Edenhuizen kaum erwarten zu studieren. Sie möchte Ärztin werden und in die Fußstapfen ihres jüngst verstorbenen Vaters treten. Frauen dürfen aber noch nicht studieren, weswegen Hermine für jede Vorlesung eine Sondergenehmigung braucht. Sie gibt nicht auf und tut alles für ihren Traum! Deshalb will sie auch niemals heiraten, ein Ehemann könnte ihr nämlich das Arbeiten verbieten.
Da lernt sie den Arzt Otto Heusler kennen. Er behandelt sie respektvoll, diskutiert medizinische Fälle mit ihr. Doch Otto ist bereits…
Vordenkerin, Medizinerin, Wegbereiterin
Berlin, 1898: Nach dem Abitur kann es Hermine Edenhuizen kaum erwarten zu studieren. Sie möchte Ärztin werden und in die Fußstapfen ihres jüngst verstorbenen Vaters treten. Frauen dürfen aber noch nicht studieren, weswegen Hermine für jede Vorlesung eine Sondergenehmigung braucht. Sie gibt nicht auf und tut alles für ihren Traum! Deshalb will sie auch niemals heiraten, ein Ehemann könnte ihr nämlich das Arbeiten verbieten.
Da lernt sie den Arzt Otto Heusler kennen. Er behandelt sie respektvoll, diskutiert medizinische Fälle mit ihr. Doch Otto ist bereits verheiratet! Hat ihre Liebe ein Chance?
Bedeutende Frauen, die die Welt verändern
Mit den historischen Romanen unserer Reihe „Bedeutende Frauen, die die Welt verändern“ entführen wir Sie in das Leben inspirierender und außergewöhnlicher Persönlichkeiten! Auf wahren Begebenheiten beruhend erschaffen unsere Autor:innen ein fulminantes Panorama aufregender Zeiten und erzählen von den großen Momenten und den kleinen Zufällen, von den schönsten Begegnungen und den tragischen Augenblicken, von den Träumen und der Liebe dieser starken Frauen.
Weitere Titel der Serie „Bedeutende Frauen, die die Welt verändern“
Über Yvonne Winkler
Aus „Ärztin einer neuen Ära (Bedeutende Frauen, die die Welt verändern 8)“
Teil 1
Wegweiser
1896
Berlin, Pewsum in Ostfriesland
Kapitel 1
Die Schulbank war alt und morsch und eigentlich für Kinder der Volksschule gezimmert. Aber Hermine Edenhuizen war kein Kind mehr. Sie war fast vierundzwanzig und damit längst aus dem üblichen Schulalter heraus. Es lag an den neuen Gymnasialkursen, dass sie sich trotzdem noch jeden Tag hinter das Pult zwängte.
Als hochgewachsene Ostfriesin überragte sie die anderen drei Kursteilnehmerinnen deutlich und musste sich ordentlich abplagen, bis sie endlich in der Bank saß. Schmerzhaft drückten ihre Knie gegen das [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Mit fiktionalen Elementen erzählt Yvonne Winkler lebhaft von Hermines Werdegang als Ärztin und ihrer Liebe zu Otto Heusler.“
designatedguys„Ein fesselnder Roman, der zeigt wie es noch vor etwa hundert Jahren war und dass man auch als einzelne Person Dinge verändern kann.“
Honey„Mitreißender Roman“
erlesen-Magazin



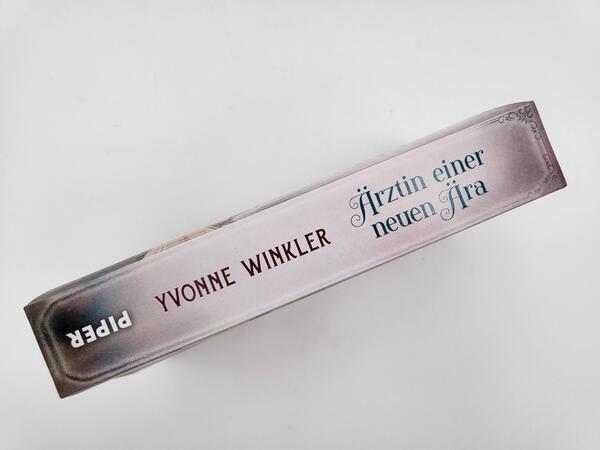



























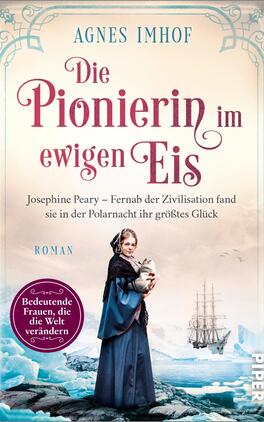


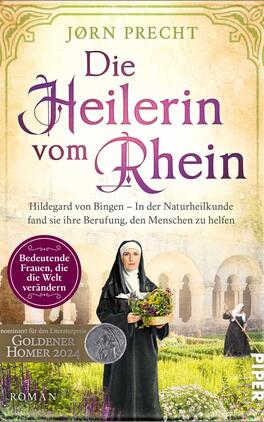


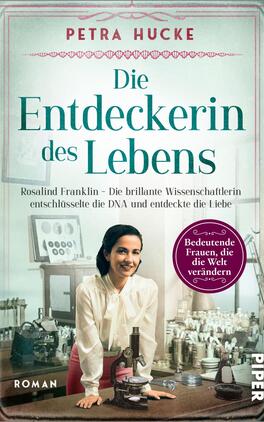









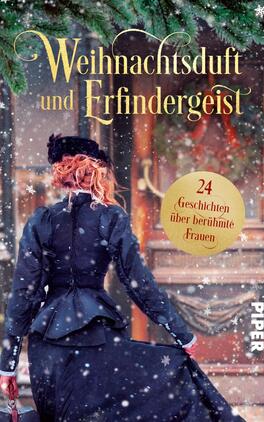
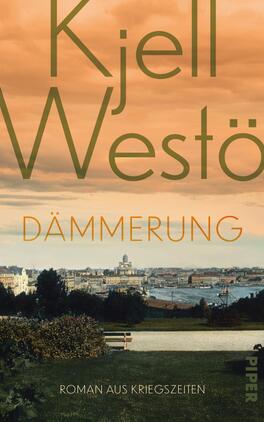
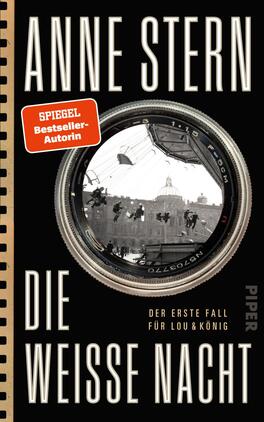



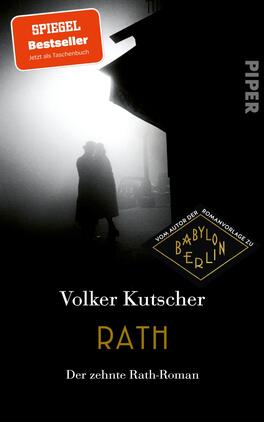





Bewertungen
Ärztin einer neuen Ära
Gesehen, gekauft, binnen 2 Tagen gelesen......... und dieses Buch hat mich begeistert. Leicht und flüssig geschrieben und zum Teil sehr erschreckend, was und vor allem wie Frauen damals und zum Teil ja auch noch heute Steine in den Weg gelegt werden. Sehr packend geschrieben, so dass man das Buc…
Gesehen, gekauft, binnen 2 Tagen gelesen......... und dieses Buch hat mich begeistert. Leicht und flüssig geschrieben und zum Teil sehr erschreckend, was und vor allem wie Frauen damals und zum Teil ja auch noch heute Steine in den Weg gelegt werden. Sehr packend geschrieben, so dass man das Buch auch nicht weglegen mag, man muss einfach weiterlesen !