Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München verarbeitet Ihre personenbezogenen
Daten (Vorname, Nachname, ** Email) zum Zwecke der Kontaktaufnahme, zur Zusendung von Autorenfotos
und zur Marktforschung (Analyse der Anfragen). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß
Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG. Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten
bestätigen Sie, dass Sie Informationen an die angegebene Adresse zugesendet erhalten möchten, und,
dass Sie mit der absendenden Person identisch sind. Für die Zusendung der Informationen speichern
wir Ihre Daten in unserem CMS
und leiten Ihre Anfrage via Outlook Ihrem zuständigen
Ansprechpartner weiter. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Ihre Daten werden solange gespeichert, wie Sie die Zusendung von Informationen wünschen. Sie haben
das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein
Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer
Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs erhalten Sie keine weiteren Marketinginformationen mehr von
uns zugesandt. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail,
press@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch
einen Brief schicken. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen
Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei
weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter
datenschutz@piper.de erreichen.

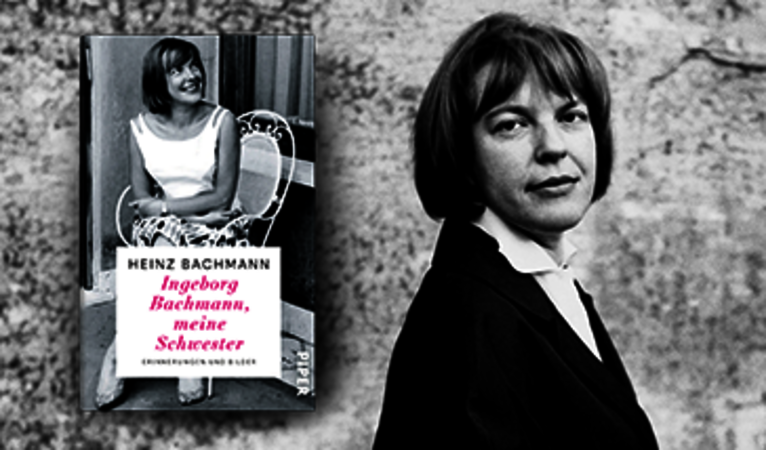
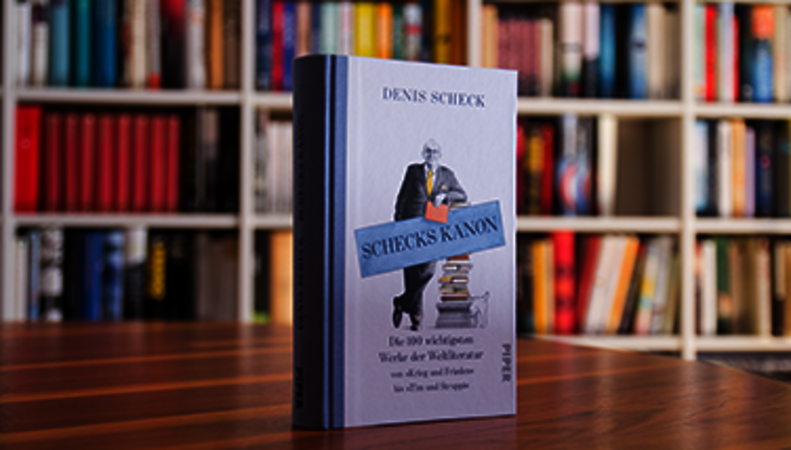

Kommentare zum Autor
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.