Umschlaggestaltung
Wie entsteht ein Buchcover? Unser Autor Timon Karl Kaleyta über den Prozess der Umschlaggestaltung und über die Zusammenarbeit mit dem Verlag
weitere Infos
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Timon Karl Kaleyta gelingt das Paradox, einen versnobten Blick von unten auf unsere Gesellschaft zu werfen“.
der Freitag - Online„Ein Buch, das das Klischee von der humorlosen deutschen Literatur widerlegt.“ Ijoma Mangold
Unser Erzähler ist vom Glück geküsst. Er, der Junge aus einfachem Hause, spürt, dass das Schicksal Großes mit ihm vorhat. Erst als Helmut Kohl 1998 die Wahl verliert, zeigt seine Zuversicht Risse. Wird nun alles schlechter?
Nach dem Abitur macht er sich voller Euphorie und dennoch maximal besorgt auf die Reise nach ganz oben. Um ein Haar erlebt er mit seiner Band den großen Erfolg, beginnt beinahe eine steile akademische Karriere, fast findet er das Glück in der Liebe und tänzelt dabei ständig am…
„Ein Buch, das das Klischee von der humorlosen deutschen Literatur widerlegt.“ Ijoma Mangold
Unser Erzähler ist vom Glück geküsst. Er, der Junge aus einfachem Hause, spürt, dass das Schicksal Großes mit ihm vorhat. Erst als Helmut Kohl 1998 die Wahl verliert, zeigt seine Zuversicht Risse. Wird nun alles schlechter?
Nach dem Abitur macht er sich voller Euphorie und dennoch maximal besorgt auf die Reise nach ganz oben. Um ein Haar erlebt er mit seiner Band den großen Erfolg, beginnt beinahe eine steile akademische Karriere, fast findet er das Glück in der Liebe und tänzelt dabei ständig am Abgrund. Doch wenn man ihm glauben will – und nichts wünscht er sich mehr –, wird am Ende alles gut für ihn.
Timon Karl Kaleyta erzählt von einem, der auszieht, um die Welt für sich zu gewinnen. Irisierend, funkelnd, schöner als der schöne Schein!
„Das lustigste Buch, das jemals in deutscher Sprache geschrieben worden ist.“ Caroline Wahl
„Ein glänzend geschriebener, ein unterhaltsamer und ein intelligenter deutscher Roman, das hat man nicht alle Tage.“ Denis Scheck
„Pausenlos gelacht und immerzu gelitten - ich kann Timon Karl Kaleyta fühlen.“ Christian Ulmen
Ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der Stadt Fulda für das beste Debüt des Jahres
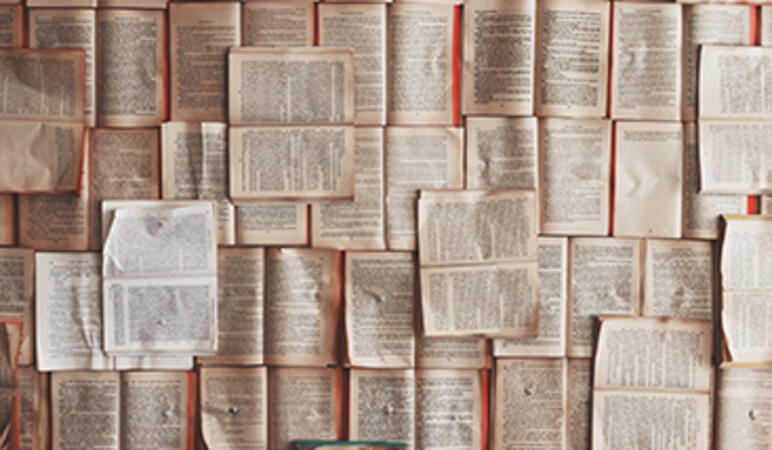
Wie entsteht ein Buchcover? Unser Autor Timon Karl Kaleyta über den Prozess der Umschlaggestaltung und über die Zusammenarbeit mit dem Verlag
weitere Infos„Der Autor, Timon Karl Kaleyta, erzählt sie (die Geschichte) in einer Art gefinkelten Offenherzigkeit, in der Attitüde eines lauteren Schelms. Dabei leiten ihn zwei erfrischende Anachronismen: eine vermeintlich antiquierte Sprache, die aber eigentlich bloß elegant ist, sowie die Sympathie für eine Figur, die glaubt, dass sie es schwerer hat als andere.“
Welt am Sonntag„In seinem ersten Roman erzählt er mit viel Humor von einem arroganten, narzisstischen, größenwahnsinnigen Kerl, der mit einer Art feigen Selbstverliebtheit durchs Leben geht.“
WDR - 1Live„So wie Kaleyta davon erzählt, wie es immer nur so gut wie und fast und beinahe und dann doch eben nicht so richtig abging mit seiner Karriere, klingt die Geschichte wie eine exemplarische Universalgeschichte. Man wünscht sich unter jede seiner Wahrheiten einen Beat.“
Süddeutsche Zeitung„Ein erstaunliches Buch! Mit schelmischer Selbstironie und Leichtherzigkeit gelingt Kaleyta eine anmutige Frechheit über unsere Klassengesellschaft.“
Samira El Quassil„Mit viel Humor, Ehrlichkeit und Selbstironie“
Ruhr Nachrichten„Fünf Jahre nach dem Wahlsieg Donald Trumps haben (...) Klassenromane nicht aufgehört, aus dem Boden zu sprießen. (...) Diesen elegischen Grundton, der schnell in politisches Pathos gewendet werden kann, ergänzt Timon Karl Kaleytas Debüt um den amüsanten Blick eines modernen Hans im Glück. Weiß Kaleyta am Ende mehr über die Klassenverhältnisse dieses Landes?“
Die Zeit„Pausenlos gelacht und immerzu gelitten“
Christian Ulmen„Es gibt Romane, die sind Balsam für die Seele, weil sie dabei helfen, Schicksalsschläge beiseite zu lachen. ›Die Geschichte eines einfachen Mannes‹ ist so ein Werk.“
Berliner Zeitung„Timon Karl Kaleyta ist ein so überragend guter Liedtexter - muss der jetzt wirklich auch noch ein Buch schreiben? Ich meine: JA!“
Benjamin von Stuckrad-Barre„Es ist vielleicht nicht das Schlechteste, wenn man über ein Buch urteilen kann, dass seine Lektüre gute Laune macht“.
B5 Aktuell„Irisierend, funkelnd, schöner als der schöne Schein!“
Youtube „Zwischenmiete NRW“„Es gibt zwei wirklich originelle Liebesgeschichten in diesem Buch über eine zuverlässig zu spät kommende Generation.“
Sächsische Zeitung„Das lustigste Buch, das jemals in deutscher Sprache geschrieben worden ist.“
Caroline Wahl„Timon Karl Kaleyta gelingt das Paradox, einen versnobten Blick von unten auf unsere Gesellschaft zu werfen“.
der Freitag - Online
Die erste Bewertung schreiben