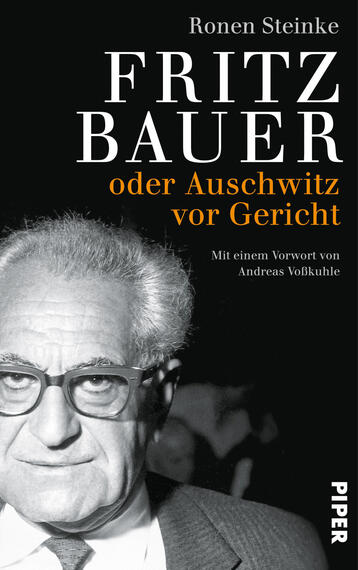
Fritz Bauer - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Ronen Steinkes großartiges Buch endet traurig und beginnt mit einer Überraschung aus dem Leben des 1903 geborenen Fritz Bauer, der das Lebensmotto hatte: ›Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg' auch keinem andern zu.‹“
vorwärtsBeschreibung
1963 dringt das Wort „Auschwitz“ mit Wucht in deutsche Wohnzimmer. Gegen 22 ehemalige NS-Schergen wird Anklage erhoben, in Frankfurt beginnt ein Mammutprozess. Ein Mann hat diesen Prozess fast im Alleingang auf den Weg gebracht: Fritz Bauer, Generalstaatsanwalt in Hessen. Ein Sozialdemokrat jüdischer Herkunft, der 1936 gerade noch hatte fliehen können. Er ist es, der die deutsche Nachkriegsgesellschaft zum Sprechen bringt und Adolf Eichmann vor ein israelisches Gericht. Im restaurativen Klima der Adenauer Zeit wird der Jurist damit zur Reizfigur, der seine Zunft erzürnt und von allen Seiten…
1963 dringt das Wort „Auschwitz“ mit Wucht in deutsche Wohnzimmer. Gegen 22 ehemalige NS-Schergen wird Anklage erhoben, in Frankfurt beginnt ein Mammutprozess. Ein Mann hat diesen Prozess fast im Alleingang auf den Weg gebracht: Fritz Bauer, Generalstaatsanwalt in Hessen. Ein Sozialdemokrat jüdischer Herkunft, der 1936 gerade noch hatte fliehen können. Er ist es, der die deutsche Nachkriegsgesellschaft zum Sprechen bringt und Adolf Eichmann vor ein israelisches Gericht. Im restaurativen Klima der Adenauer Zeit wird der Jurist damit zur Reizfigur, der seine Zunft erzürnt und von allen Seiten angefeindet wird: „Wenn ich mein Büro verlasse, betrete ich feindliches Ausland“, so beschreibt er seine Lage. Ronen Steinke erzählt das Leben des Mannes, der mit seiner Courage ein ganzes Land veränderte.
Über Ronen Steinke
Aus „Fritz Bauer“
Vorwort
Mit Furchtlosigkeit und Beharrungsvermögen, mit Kampfesmut und einer schier unerschöpflichen Ausdauer stellte Fritz Bauer sein Leben in den Dienst der Humanität. Das leidenschaftliche Eintreten für eine im besten Sinne aufgeklärte Gesellschaft ist ein Leitmotiv seiner Biografie. Dieses Leitmotiv ist erkennbar in seinem Einsatz für eine rationale Strafrechtspraxis, den er als junger Stuttgarter Richter zeigte. Präsent ist es auch in seiner hartnäckigen Verteidigung der Weimarer Republik als der ersten Demokratie auf deutschem Boden. Vor allem aber zeugt von [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Aus der scheinbar trockenen Justiz-Materie macht Steinke ein spannendes und bewegendes Buch, das eine ungeheure Sogwirkung entfaltet.“
Offenbach-Post„Fesselnd zu lesende Biografie.“
Neue Zürcher Zeitung„Eindrucksvoll (...). Steinke zeichnet nicht nur das einseitige Bild eines mutigen Helden, der sich gegen den Zeitgeist stellt. Er legt auch dessen Schwächen offen.“
Deutschlandradio Kultur„Eine Biografie aus der Feder eines gleichermaßen als Jurist und Journalist qualifizierten Autors: Ronen Steinke. Seine vertiefte Biografie Fritz Bauers kann sich auf neues Material (...) stützen (...). Steinke ist kein Enthüllungsjournalist im unguten Sinne, aber er hat Dinge mitzuteilen, die Fritz Bauer Amt und Karriere hätten kosten können.“
Der Tagesspiegel„Bauer war die Person, die die Mauer des Schweigens durchbrochen hat", sagt Steinke.“
wyborcza.pl„Die Biographie über Fritz Bauer enthält inhaltlich Neues über Bauers Studienzeit, Leben und Schaffen im Exil, ist aber vor allem als ein einfühlsames Porträt und zudem stilistisch gelungen.“
taz„Kenntnis- und facettenreich.“
konkret„Die Standard-Biografie zu Fritz Bauer.“
allgemeine-zeitung.de„Es gibt nicht viele deutsche Journalisten die so häufig (…) und so gut über das Völkerrecht schreiben wie Ronen Steinke.“
ZDF - Markus Lanz„Ronen Steinke liefert in seiner Biografie das Psychogramm eines mit seiner Identität hadernden, massiv angefeindeten Aufklärers, in dessen Person sich der Umgang der Deutschen mit ihrer Geschichte vielfältig spiegelt.“
WDR 3„Manchmal liest sich diese Biografie wie ein Krimi. (...) Erschreckend, entlarvend, ernüchternd. (...) Steinke gelingt es, Bauers Lebensdrama klar und diskret herauszuarbeiten.“
Radio Bremen„Ein wichtiges Buch, brillant geschrieben.“
Passauer Neue Presse„Steinke hat nicht nur ein spannendes, gut zu lesendes Buch geschrieben. Es ist eine Arbeit, die sehr einfühlsam und deutlich die 1950er und 1960er im Westen Deutschlands beschreibt.“
Neues Deutschland„Spannend zu lesendes Buch“
NaturFreunde Hessen„Steinke erschließt auch neue Quellen über die frühen Jahre.“
NZZ am Sonntag - Bücher am Sonntag (CH)„Pflichtlektüre für Juristen.“
Münchner Merkur„Dem Biograf gelingt, mit Bildern wie diesen nicht nur die großen Spannungen unter der Oberfläche einer boomenden Nachkriegsgesellschaft einzufangen. Subtil und eindrucksvoll erzählt er vor allem das Drama eines Menschen. Die Biografie schreibt keine Atmosphäre herbei oder trägt künstlich Pathos auf. Die Mischung aus journalistischer Hartnäckigkeit, dem genauen Blick des Historikers und beinahe literarischer Erzählkraft entfaltet beim Lesen eine ungeheure Sogwirkung.“
Legal Tribune Online„Das Ergebnis ist eine lebensecht Abhandlung, die beim Leser ein bleibendes Bild vom Charakter Fritz Bauers hinterlässt.“
Kritische Justiz„Ronen Steinke verdient Dank, dass er die Botschaft Fritz Bauers in der angemessenen Mischung aus professioneller Distanz und dosierter Anteilnahme, und spannend lesbar, noch einmal in Erinnerung gerufen hat.“
Juristen Zeitung„Eine ähnlich zugängliche, packende und intellektuell anregende Biographie lässt sich schwerlich finden. Es dürfte auf Jahre das ideale Geschenk für angehende Juristinnen und Juristen sein.“
Journal für Juristische Zeitgeschichte„Ronen Steinkes einfühlsames Buch verdient ausführliche Lektüre und vor allem nachhaltiges Engagement von jedem von uns gegen alte und neue Nazi-Parolen.“
IPG-Journal.de„Alles in allem zeichnet Steinke ein Porträt des Frankfurter Generalstaatsanwalts, das persönlicher, nuancierter und farbenreicher ausfällt als frühere Darstellungen.“
Historische Zeitschrift„Das neue Buch ist wichtig, schon allein, weil es veröffentlicht wurde.“
Haaretz„Was Steinkes Bauer-Biografie (...) auszeichnet, ist die gelungene Erzählung, ihre atmosphärische Dichte. (...) So nachempfunden kommt die Erzählung dem ›historischen, rechtlichen und moralischen Unterricht‹ nahe, als den Bauer die Auschwitzprozesse verstanden wissen wollte.“
Frankfurter Rundschau„Steinke hat sein Buch (...) mit der Akribie eines Juristen recherchiert. Geschrieben ist es mit journalistischer Feder, sehr lesbar.“
Frankfurter Neue Presse„Faszinierendes Buch.“
Dresdner Morgenpost am Sonntag„Eine exzellente Biografie.“
Die ZEIT„Ronen Steinkes würdigende Biografie ist eine Einladung, die Bedeutung eines großen deutschen Juristen genauer zu erkunden.“
Deutschlandfunk„Der Glücksfall einer spannend geschriebenen politischen Biografie.“
Darmstädter Echo„Sensibel und zuverlässig.“
Darmstädter Echo„Es ist sehr zu begrüßen, dass mit diesem Buch eines jungen Juristen an sein Leben und unvergessliches Wirken erinnert wird.“
Buchtips.net„Steinke hat ein packendes Buch geschrieben.“
ARD - TTT - Titel Thesen Temperamente„Ronen Steinkes großartiges Buch endet traurig und beginnt mit einer Überraschung aus dem Leben des 1903 geborenen Fritz Bauer, der das Lebensmotto hatte: ›Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg' auch keinem andern zu.‹“
vorwärtsVorwort von Andreas Voßkuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts
1 Der Deutsche, der Eichmann vor Gericht brachte: Sein Geheimnis
2 Ein jüdisches Leben: Worüber der umstrittenste Jurist der Nachkriegszeit nie spricht
Ein Feuerkopf verstummt: Dr. Bauers gesammeltes Schweigen • Eine Familie, die dazugehören will: Kindheit in der Kaiserzeit • Chanukka und Bar Mitzwa: Erziehung zum Selbstbewusstsein
3 Bildungsjahre 1921 – 1925: Die Talente erwachen
23 Freunde • Eine jüdische Studentenverbindung • „Bekenntnis zum Deutschtum“: Zwist mit Zionisten • Tübingen, die Höhle des Löwen • Eine Doktorarbeit, über die sich Industriebarone freuen
4 Richter in der Weimarer Republik: Im Kampf gegen das aufziehende Unheil
Es pocht am Dienstzimmer • Ein Roter unter Schwarz-Weiß-Roten: Parallelwelt Justiz • „Deckt das Justizministerium das Verhalten des Juden Bauer?“ • Im Duo mit Kurt Schumacher: Straßenkampf gegen die SA
5 Konzentrationslager und Exil bis 1949
Im Konzentrationslager • Dänemark 1936: Wie ein Delinquent auf Bewährung • Qualen der Abgeschiedenheit • Die Deutschen rücken näher • Schweden 1943: An der Seite Willy Brandts • Wie Fritz Bauer seine Doktorarbeit zerreißt • „Inopportun“: Als Jude in der Politik nach 1945 nicht erwünscht
6 Die Rehabilitierung der Männer des 20. Juli: Sein Verdienst
Der Emigrant gegen die Nazi-Wiedergänger: Der Remer-Prozess 1952 • Generalstaatsanwalt in Braunschweig 1950 • „Die Frage wirkt sofort elektrisierend“: Ein Land diskutiert den Widerstand • „Mein Mitschüler Stauffenberg“: Ein Plädoyer, das Geschichte schreibt
7 „Mörder unter uns“: Psychogramm eines Anklägers
Wozu Strafe? • „Ich habe gewusst, wohin ich gehören möchte“: Der Traum vom humanen Strafrecht • Die Speerspitze des Fortschritts: Jugendrichter 1928 • Das Nürnberger Tribunal 1945, leuchtendes Vorbild und abschreckendes Beispiel • „Ihr hättet Nein sagen müssen“: Ein Staatsanwalt, der den Rechtsbruch verlangt
8 Der große Auschwitz-Prozess 1963 – 1965: Sein Hauptwerk
Eine Cola in der Verhandlungspause • Eine Bühne für das, was die Welt nicht erfahren sollte: Bauers Leistung • Warum der Atheist mit Jesus argumentiert (und nie wieder mit Moses) • Ein Querschnitt durchs Lager: Bauers Strategie • Anfeindungen als vermeintlich unobjektives NS-Opfer • Ein Regisseur, der sich in der Kulisse versteckt: Bauers eigene Rolle
9 Verteidigung des Privaten: Sein Dilemma
Der Bohemien: Bauer privat • Reaktionärer Muff im Strafgesetzbuch und die Pflichten eines Generalstaatsanwalts • Freund der Schwulen: Bauer in der Debatte um den Paragrafen 175
10 Der Weg in die Einsamkeit: Seine Tragik
Angst vor der Nähe: Der Jurist und die Juden •„Mit ihm konnte man nicht reden“: Fritz Bauers junges Ankläger-Team • „Die Linken kommen immer mit ihren Utopien“: Enttäuschungen am Lebensende
11 Der Tote in der Badewanne 1968
Anhang
Dank
Quellen und Literatur
Anmerkungen
Personenregister
Bildnachweis




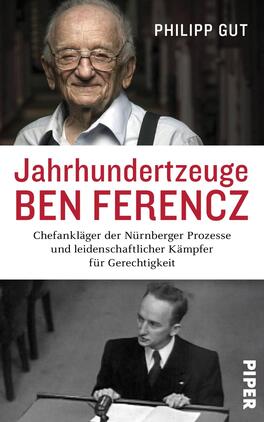
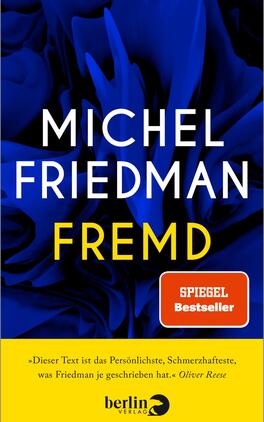
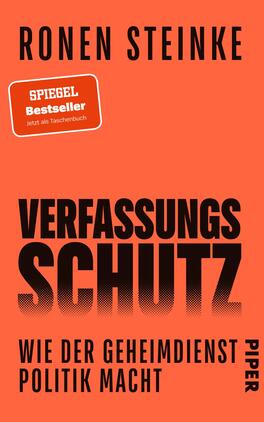

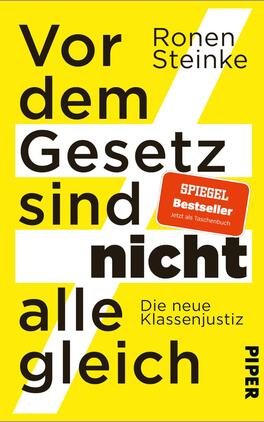
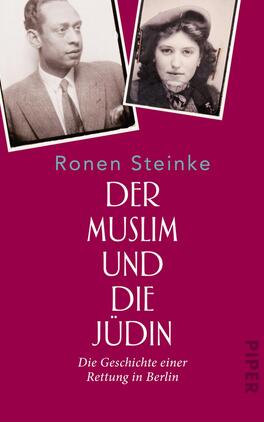
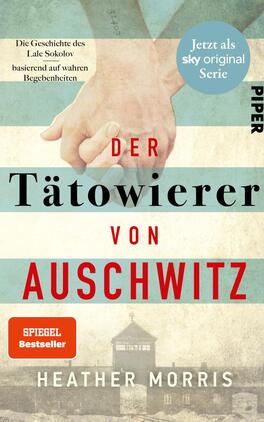
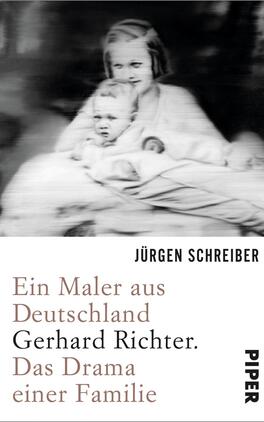
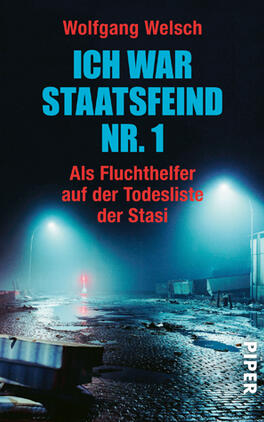
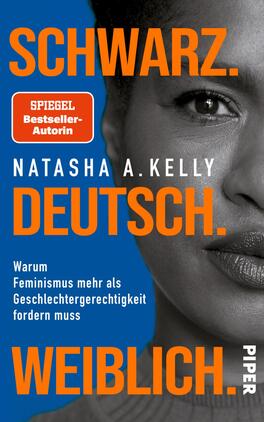
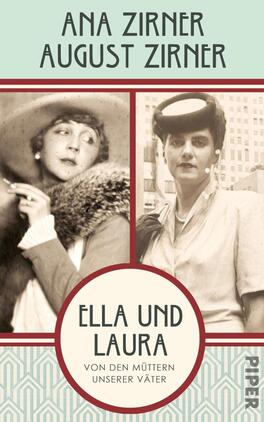
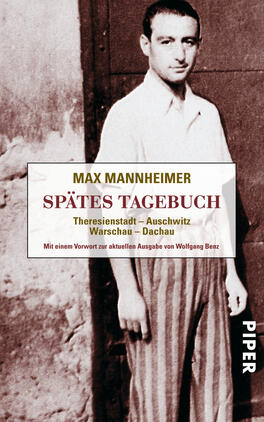



Die erste Bewertung schreiben