Bücher von Ronald Reng
Im neuesten Buch des Bestsellerautors Ronald Reng "1974 - eine deutsche Begegnung" geht es um das einzige Fußballspiel zwischen der BRD und der DDR.
weitere Infos
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Aufstieg, Erfolg und Scheitern dreier ganz normaler Fußballjungs
Nur eines unterscheidet Fotios, Marius und Niko von ihren Freunden in der nordbayerischen Provinz: Sie spielen alle drei unwiderstehlich gut Fußball. Noch bevor sie 14 werden, nehmen die Profiklubs 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth sie in ihre Leistungszentren auf. Von da an führen ihre Leben in neue, unvermutete Richtungen. - Ein Buch über drei fantastische Jungs, die dribbeln wie Messi und von großen Karrieren träumen.
Ronald Reng hat die drei begleitet, hat neun Jahre lang Dramatik und Glück, Einsichten…
Aufstieg, Erfolg und Scheitern dreier ganz normaler Fußballjungs
Nur eines unterscheidet Fotios, Marius und Niko von ihren Freunden in der nordbayerischen Provinz: Sie spielen alle drei unwiderstehlich gut Fußball. Noch bevor sie 14 werden, nehmen die Profiklubs 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth sie in ihre Leistungszentren auf. Von da an führen ihre Leben in neue, unvermutete Richtungen. - Ein Buch über drei fantastische Jungs, die dribbeln wie Messi und von großen Karrieren träumen.
Ronald Reng hat die drei begleitet, hat neun Jahre lang Dramatik und Glück, Einsichten und schwere Entscheidungen miterlebt, das Scheitern und Gelingen eines großes Traums.
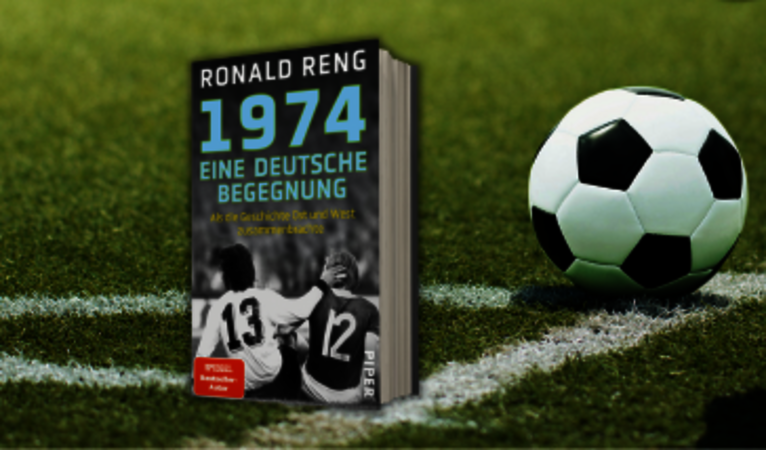
Im neuesten Buch des Bestsellerautors Ronald Reng "1974 - eine deutsche Begegnung" geht es um das einzige Fußballspiel zwischen der BRD und der DDR.
weitere Infos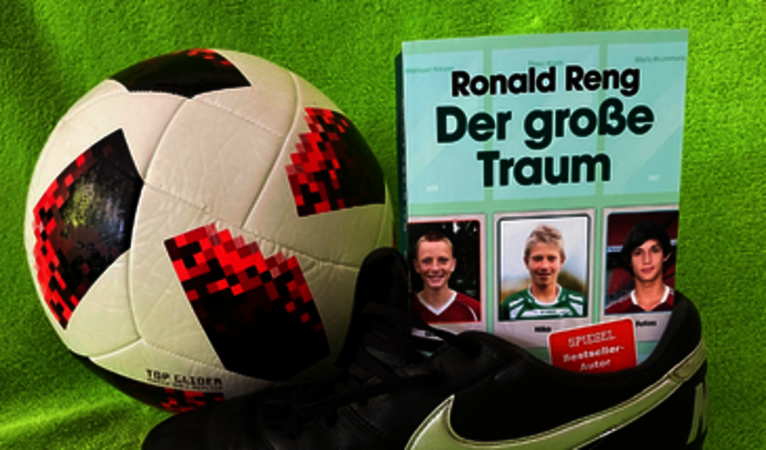
Ronald Rengs „Der große Traum“ wurde zum Fußballbuch des Jahres 2022 gekürt.
weitere Infos
Die erste Bewertung schreiben