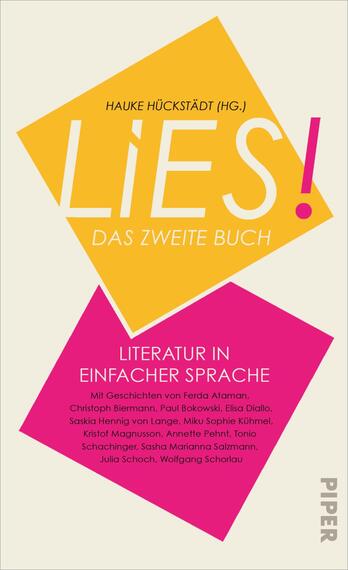
LiES. Das zweite Buch - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Literarische Inklusion: Der 2. Erzählungsband in einfacher Sprache
Dass Literatur nicht kompliziert oder wortgewaltig sein muss, hat die erste Sammlung von Geschichten in einfacher Sprache gezeigt. Und dass wir alle etwas lernen können, wenn wir uns auf diese besondere Art zu erzählen einlassen. Hauke Hückstädt hat das Experiment fortgesetzt. Immer mit dem unbedingten Wunsch, dass alle Menschen die Möglichkeit haben sollen, einen Zugang zur Literatur zu finden.
Die zwölf neuen Geschichten von renommierten Autor:innen u.a. von Elisa Diallo, Sasha Marianna Salzmann und Kristof Magnusson eröffnen…
Literarische Inklusion: Der 2. Erzählungsband in einfacher Sprache
Dass Literatur nicht kompliziert oder wortgewaltig sein muss, hat die erste Sammlung von Geschichten in einfacher Sprache gezeigt. Und dass wir alle etwas lernen können, wenn wir uns auf diese besondere Art zu erzählen einlassen. Hauke Hückstädt hat das Experiment fortgesetzt. Immer mit dem unbedingten Wunsch, dass alle Menschen die Möglichkeit haben sollen, einen Zugang zur Literatur zu finden.
Die zwölf neuen Geschichten von renommierten Autor:innen u.a. von Elisa Diallo, Sasha Marianna Salzmann und Kristof Magnusson eröffnen mit ihrer sprachlichen Einfachheit ungeahnte Weite und Tiefe. Ein Lesevergnügen für alle!
Aus „LiES. Das zweite Buch“
Amerika! –
Von Elisa Diallo
Vor einigen Jahren habe ich eine Einladung nach New York bekommen.
Es war für die Arbeit.
Ich lebte damals in Paris, wo ich aufgewachsen bin.
In Amerika war ich vorher noch nie.
New York kannte ich nur von Filmen und vom Fernsehen.
Über die Einladung und die Reise freute ich mich.
Stolz war ich auch, und ich erzählte meinem Vater davon.
Mein Vater sagte:
In New York lebt der Cousin Hassimiou.
Wenn du dahin reist, musst du ihn besuchen.
„Cousins“ und „Cousinen“ nennt mein Vater alle Menschen, die aus demselben Dorf kommen wie er.
Aus dem Dorf in [...]



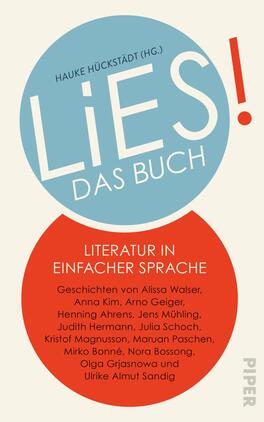
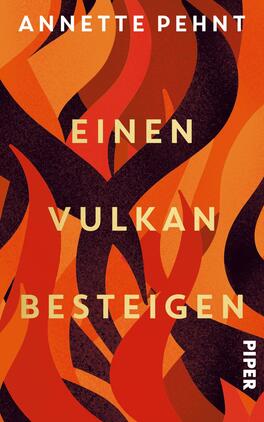
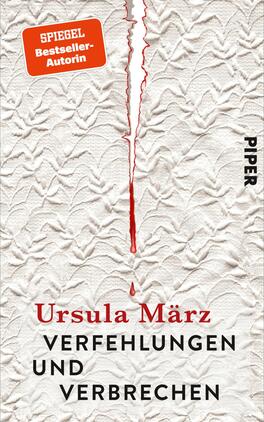
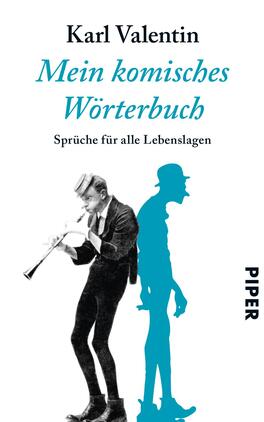
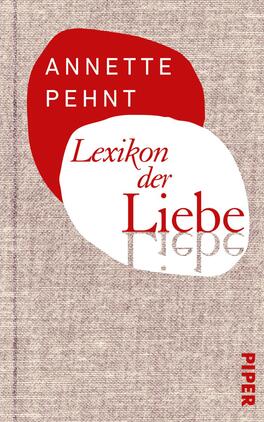

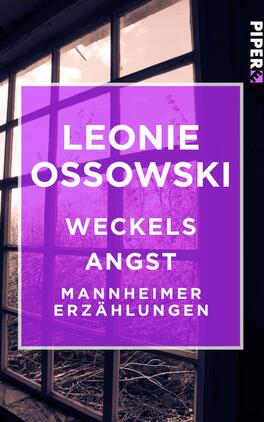

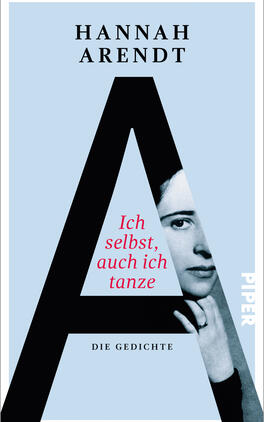

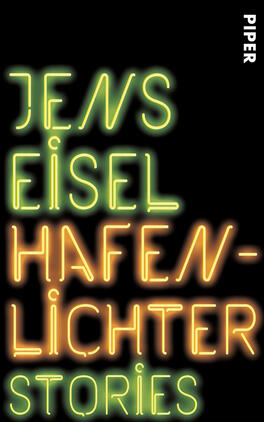
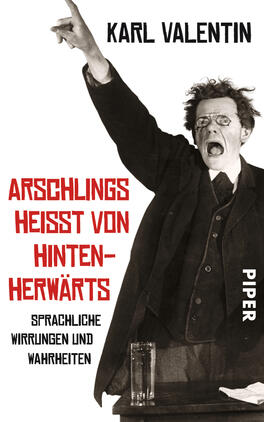

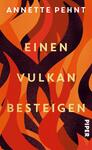

Die erste Bewertung schreiben