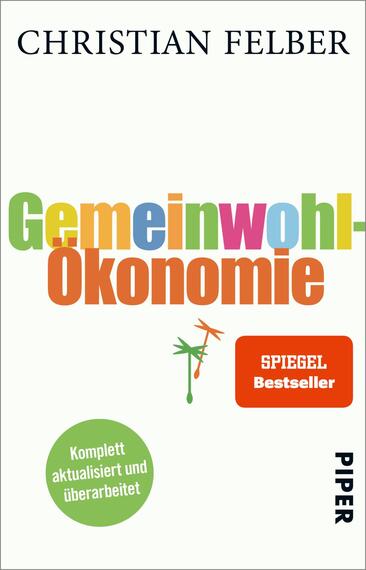
Gemeinwohl-Ökonomie
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Dieses Buch oder die Idee, die dahinter steht, ist in der Lage unser derzeitiges Wirtschaftssystem einfach einen Schritt weiterzubringen.“
ZDF „Aspekte“Beschreibung
Solidarität statt Konkurrenzkampf: das Manifest eines neuen Wirtschaftssystems
Wie funktioniert eine Ökonomie, in der Unternehmen und Individuen kooperieren, statt sich zu bekämpfen? Christian Felbers revolutionärer Bestseller findet eine praxistaugliche Antwort.
Als die Reformbewegung der Gemeinwohl-Ökonomie im Jahr 2010 erstmals für Aufmerksamkeit sorgte, wurden die Megathemen Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratisierte Wirtschaft zwar heiß diskutiert, doch es gab kein Wirtschaftsmodell, das diese Anforderungen praktisch und tragfähig umsetzt.
Christian Felber sollte dies…
Solidarität statt Konkurrenzkampf: das Manifest eines neuen Wirtschaftssystems
Wie funktioniert eine Ökonomie, in der Unternehmen und Individuen kooperieren, statt sich zu bekämpfen? Christian Felbers revolutionärer Bestseller findet eine praxistaugliche Antwort.
Als die Reformbewegung der Gemeinwohl-Ökonomie im Jahr 2010 erstmals für Aufmerksamkeit sorgte, wurden die Megathemen Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratisierte Wirtschaft zwar heiß diskutiert, doch es gab kein Wirtschaftsmodell, das diese Anforderungen praktisch und tragfähig umsetzt.
Christian Felber sollte dies ändern. Schon mit der ersten Auflage von „Gemeinwohl-Ökonomie“ konnte das Gründungsmitglied von Attac Österreich beweisen, dass eine Wirtschaft besser funktioniert, wenn eigenständige Unternehmen und Initiativen zusammen für ethische Werte eintreten, statt nur auf den eigenen Profit zu schauen.
Nur wenige Jahre später arbeiten bereits mehr als 2.300 Unternehmen nach den Grundsätzen der Gemeinwohl-Ökonomie. Auch öffentliche Institutionen und Privatpersonen zählen zum wachsenden Netzwerk.
„Gemeinwohl-Ökonomie ist die Verkörperung dessen, womit wir uns seit Jahren in Sachen Nachhaltigkeit und Transparenz auseinandersetzen.“ – sz.de
Christian Felbers theoretisches Konzept und Manifest zur Gemeinwohl-Ökonomie ist gleichzeitig Impulsgeber und Aufklärungsbuch, Kompass und Denkanreiz – nicht nur für Unternehmer und Unternehmen, sondern für alle, die Wirtschaft aus einem völlig neuen Blickwinkel verstehen wollen.
Der SPIEGEL-Bestseller – komplett aktualisiert und überarbeitet
In der aktualisierten Ausgabe von „Gemeinwohl-Ökonomie“ finden Sie neue Quellen, mehr erklärende Grafiken und Tabellen, neue Fakten und Kapitel sowie aktuelle Anregungen für ein neues Wirtschaftsmodell.
Medien zu „Gemeinwohl-Ökonomie“
Über Christian Felber
Aus „Gemeinwohl-Ökonomie“
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Es gibt immer eine Alternative.
There is always an alternative.
Für Margaret Thatcher
und Angela Merkel
Bei der Redaktion dieser Taschenbuchausgabe ist es ziemlich genau
sieben Jahre her, dass die Vorbereitungsgruppe der Gemeinwohl-
Ökonomie erstmals an die Öffentlichkeit ging, um auszuloten,
ob es eine Resonanz auf die junge Idee geben würde. Sie zündete.
Sieben Jahre später sind dreißig Fördervereine von Schweden bis
Chile am Start, mehr als 2300 Unternehmen unterstützen die Bewegung
offiziell, und immer mehr Gemeinden machen sich auf
den Weg [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Was hat sich seit der Erstauflage der „Gemeinwohlökonomie“ 2010 an unserer Wirtschaftsordnung getan?
Im größeren Bild haben wir uns von der Gemeinwohl-Orientierung tendenziell weg bewegt. Es begann mit den Bankenrettungen mit Steuergeld, anstatt mit dem Geld der Eigentümer:innen und Gläubiger:innen; einer jüngsten Studie zufolge hat die Bankenrettung den EU-SteuerzahlerInnen netto 213 Milliarden Euro gekostet – dieses Geld fehlt in der Armutsbekämpfung, in der Bildung und in der öffentlichen Infrastruktur.
Durch Geldmangel in öffentlichen Kassen werden Privatisierungen begünstigt, die das Alltagsleben für die Mittel- und Unterschicht noch teurer und schwieriger machen: Am unteren Rand der Gesellschaft steigt das Stressniveau. Das ist ein Mitgrund für die wachsenden Zweifel am Freihandelsglauben, auch der zerrt Gesellschaften auseinander anstatt das „Wohl aller“ zu mehren. Dennoch geht es leider weiter in diese Richtung, der vorläufige Höhepunkt sind die direkten Klagerechte für Konzerne gegen Staaten, während die Menschenrechte weiterhin nicht auf gleicher – globaler – Ebene eingeklagt werden können.
Inmitten dieser „falschen Wirtschaftsleben“ wachsen zum Glück auch viele kleine richtige, von Permakultur bis Transition Town, von Commons bis Gemeinwohl-Ökonomie. Doch keines von ihnen ist derzeit „systemrelevant“. Zwar beobachten wir einen foranschreitenden Bewusstseinswandel im Sinne des Erkennens der notwendigen Transformation der bestehenden Ordnung, doch im konkreten Alltag des Wirtschaftslebens freuen wir uns über jedes einzelne Unternehmen, das eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt und jede neue Gemeinde, die einen Schritt setzt.
Welche sind die wichtigsten Änderungen in der Taschenbuchausgabe?
Ich habe den gesamten Text gründlich überarbeitet, präzisiert und mit zusätzlichen Quellen versehen. Dabei sind einige Überraschungen aufgetreten, so war Eigentum beispielsweise für John Stuart Mill „nur Mittel zum Zweck, nicht Selbstzweck“. Für Friedrich Wilhelm Raiffeisen war Geld „nicht Zweck, sondern Mittel zum Zweck“. Und für den angesehenen St. Gallener Wirtschaftsethiker Peter Ulrich ist das gesamte „Wirtschaften [ist] ja nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck des guten Lebens.“
Die GWÖ-Idee ist, über die Zeiten und Köpfe verstreut, also schon immer präsent. Gänzlich neu geschrieben sind die Kapitel „Geld als öffentliches Gut“ und „Umsetzungsstrategie“ – die Bewegung ist ja hochlebendig und international äußerst dynamisch, fast täglich ereilen uns gute Nachrichten aus der lokalen und regionalen Umsetzung. Und schließlich wurde die 20-Punkte-Zusammenfassung am Ende durch eine Liste möglicher „Fragen an den demokratischen Wirtschaftskonvent“ ersetzt, damit für die Leser:in plastisch vorstellbar wird, wie die Fundamente der Wirtschaftsordnung in Zukunft vom demokratischen Souverän direkt geändert werden könnten.
Wo beginnen sich mögliche systemische Wirkungen der Gemeinwohl-Ökonomie abzuzeichnen?
Am weitesten voran ist das spanische Region Valencia, insgesamt drei Gesetze beziehungsweise Regierungserlässe sind dort schon durch oder in Vorbereitung. Zuerst ginge es um die Förderung von Gemeinwohl-Bilanzen in Unternehmen, dann um ein landesweites Register von Unternehmen mit auditierter Gemeinwohl-Bilanz, um diese in einem dritten Schritt zu fördern: über die öffentliche Beschaffung, die Wirtschaftsförderung und sogar differnezierte Steuern.
Der im Juni 2017 gestartete Lehrstuhl Gemeinwohl-Ökonomie an der Universität Valencia hilft nicht nur bei der Weiterentwicklung des theoretischen Überbaus, sondern auch bei der Erforschung der Umsetzungspraxis und bei der Ausbildung von ProfessionistInnen, welche die Unternehmen begleiten, beraten und auditieren. Jetzt ist die erste Staffel von Gemeinwohl-Gemeinden am Start. Meine große Vision ist der erste demokratische Wirtschaftskonvent, in dem über die großen Fragen der Wirtschaftsordnung partizipativ verhandelt und absgestimmt wird – von den BürgerInnen.
Das ebenfalls von Ihnen initiierte „Projekt Bank für Gemeinwohl“ in Österreich bezeichnen Sie manchmal als „kleine Zwillinsgsschwester“ der GWÖ. Wie ist der Stand des Projekts und wie kann man die Bewegung noch unterstützen?
6.000 Genossenschafter:innen sind an Bord der Genossenschaft für Gemeinwohl, rund vier Millionen Euro gesammelt, rund die Hälfte davon ist in Cash vorhanden. Wir haben die Gemeinwohl-Prüfung entwickelt und über unsere eigene Crowdfunding-Plattform die ersten fünf gemeinwohlgeprüften Projekte erfolgreich finanziert: von kommunalem Solarstrom bis zu solidarischer Landwirtschaft. Der aktuelle Knackpunkt: Unser 250 Seiten starker Konzessionsantrag für das – risikoarme – Gemeinwohl-Konto wurde von der Finanzmarktaufsicht in 227 Punkten beanstandet. Wir haben die Fragen vollständig beantwortet und warten nun auf eine Entscheidung. Während wir weiterhin versuchen, die Konzession zu bekommen, sondieren wir mit der ethischen deutschen GLS Optionen für vertiefte Kooperation. In der einen oder anderen Form wird die Gemeinwohl-Bank kommen!
Was ist momentan das Ihnen bekannte Unternehmen mit dem höchsten Gemeinwohl-Bilanz-Ergebnis?
Mir fallen gleich vier ein: zum einen Oikopolis in Luxemburg, das ist der „nationale“ Biogroßhändler, aus BiobäuerInnengenossenschaften entstanden. Zum anderen El Puente aus dem Raum Hannover, die mehr als nur fair handeln, eben umfassend gemeinwohlorientiert. Drittens die „Grüne Erde“ aus Oberösterreich, ein nachhaltiger Versandhandel, der selbst Möbel, Heimtextilien und vieles mehr herstellt. Und schließlich einer unserer ersten Pioniere, die Demeter-Bäckerei Märkisches Landbrot in Berlin, die nicht nur ihre optimale Größe gefunden hat und weiterem Wachstum trotzt; sondern dort legen die zuliefernden Bauern die Getreidepreise am runden Tisch fest – sachlich und menschlich nach angefallenen Kosten und dem lebensnotwendigen Bedarf.
Wie leben Sie selbst im Sinne des Gemeinwohls und wie können die Leser:innen Ihres Buches Ihrem Aufruf „Gestalten auch Sie eine neue Wirtschaftsordnung mit!“ folgen?
Das geht von ganz innen nach ganz außen. Zuerst frage ich mich, was ich tatsächlich brauche, um glücklich zu sein und wie verbunden ich mit dem großen Ganzen bin, wie ich meine Beziehungen pflege. Ganz oft ist die Antwort, ich brauche weniger Konsum und mehr Qualität an Zeit, Körperlichkeit, Gemeinschaft, Umwelt, Demokratie und Sinn: alles immaterielle und nicht käufliche Güter.
Persönliche habe ich weder Auto noch Fernseher, ich fliege privat nicht (beruflich leider umso mehr). Dafür tanze ich und esse viel bio. Zum anderen entwickle ich selbst neue Formen des Wirtschaftens, eine Gemeinwohl-Bank, ein gemeinwohlorientiertes Wirtschafts- und ein ethisches Handelssystem …
Die Entwicklung solcher „systemischer“ Alternativen hängt zusammen mit der Suche nach neuen Formen von Demokratie. In einer „souveränen Demokratie“, wie sie mir vorschwebt, errichten die Menschen die Grundpfeiler der Handels-, Finanz- und Wirtschaftsordnung, die Regierungen und Parlamente gestalten sie dann aus. Zu so einem „Souveränsbewusstsein“ zählt auch, die Wirtschaft und die Technik nicht den Experten allein zu überlassen, sondern die Letztverantwortung bei den betroffenen Menschen zu belassen.
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
1. Kurzanalyse
2. Die Gemeinwohl-Ökonomie – der Kern
3. Geld als öffentliches Gut
4. Eigentum
5. Motivation und Sinn
6. Weiterentwicklung der Demokratie
7. Beispiele, Verwandte und Vorbilder
8. Umsetzungsstrategie
9. Häufig gestellte Fragen
Anhang 1: Zahlen & Fakten
Anhang 2: Mögliche Fragen an den demokratischen
Wirtschaftskonvent
Anmerkungen
Literatur
Dank





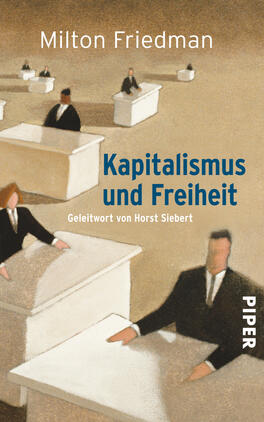
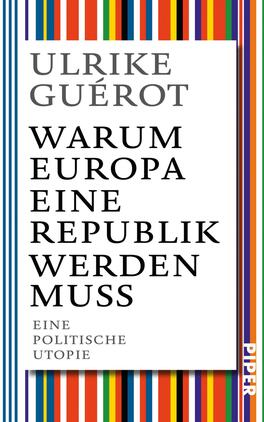
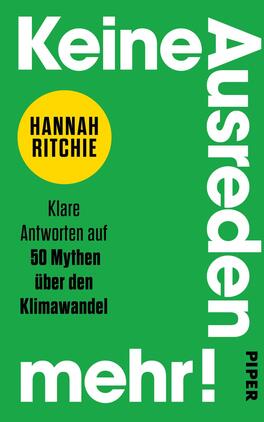

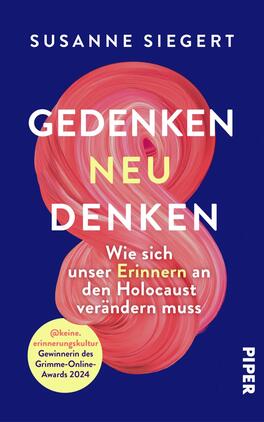
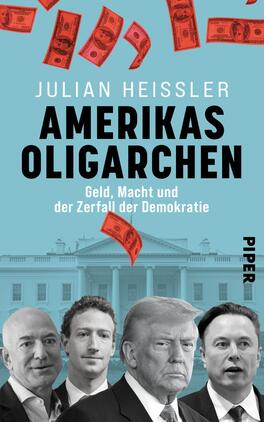
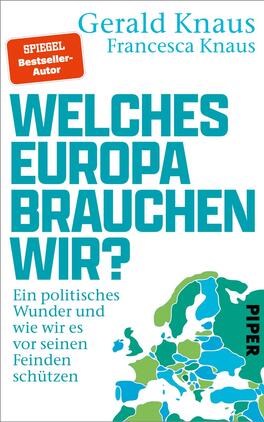
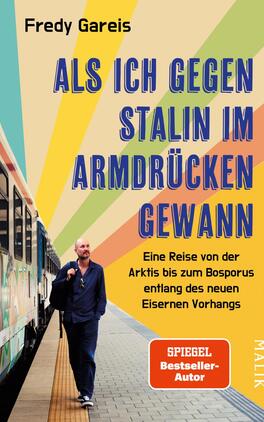
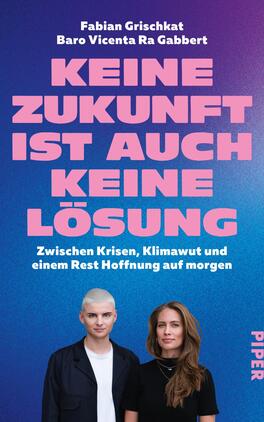
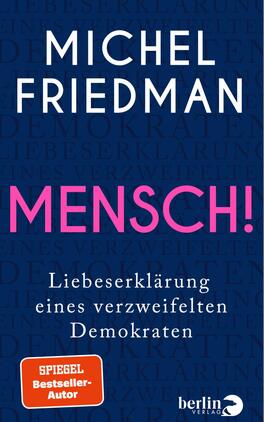
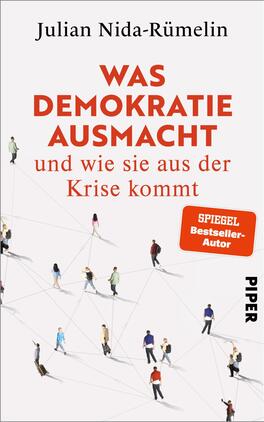

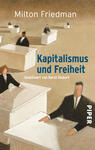


Bewertungen
Wären E-Books im Sinne der Gemeinwohlökonomie?
Christian Felber hat eine Idee und die muss er umfangreich erklären, denn unsereins rutscht schon beim Lesen immer wieder in die alten Muster -> Wird es ohne Geld gehen? Ist Geld nicht das Wichtigste? Wieso steht der Mensch im Mittelpunkt? Ohne Gewinne geht gar nichts. ... <- . Und wenn es …
Christian Felber hat eine Idee und die muss er umfangreich erklären, denn unsereins rutscht schon beim Lesen immer wieder in die alten Muster -> Wird es ohne Geld gehen? Ist Geld nicht das Wichtigste? Wieso steht der Mensch im Mittelpunkt? Ohne Gewinne geht gar nichts. ... <- . Und wenn es ausgelesen ist, hilft der Gang zur örtlichen Gemeinwohlökonomie-Gruppe. Denn es gibt sie. Und es gibt bereits Firmen und Betriebe, die sich zertifizieren ließen.
Es klingt trotzdem unmöglich.
Und jetzt noch eine Frage an den Verlag:
Wann kommt dies Buch als E-Book? Es wäre haltbarer, leichter zu transportieren und für Menschen mit Sehbehinderungen und körperlichen Einschränkungen, die das Halten eines Buches erschweren, leichter zu lesen.
Mit freundlichem Gruß, Dorothee Janssen