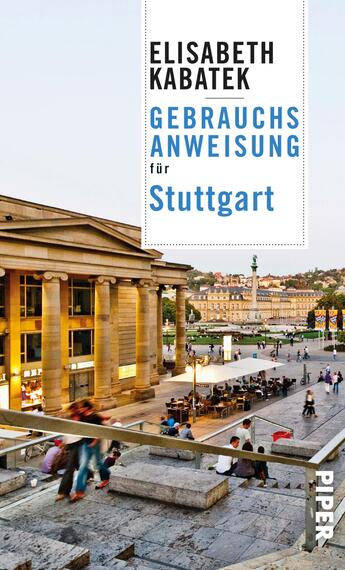
Gebrauchsanweisung für Stuttgart
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Eine spannende Lektüre: sowohl für die Einheimischen, die einen neunen Blick auf ihre Heimat gewinnen, als auch für die Reisenden, die an Necker und Nesenbach ein schönes Wochenende verleben wollen.“
Stuttgarter ZeitungBeschreibung
„Eine spannende Lektüre“ Stuttgarter Nachrichten
„Net g’schempft isch g’nug g’lobt.“ So viel Tiefstapelei ist symptomatisch für die Stuttgarter. Dabei haben sie allen Grund, ihre Stadt zu lieben: Sternegastronomie und Waldheime, das Sommerfestival der Kulturen, die Pünktlichkeit der U-Bahnen, Qualitätsweine und das Understatement der Bewohner – das alles macht hiesige Lebensqualität aus.
Scharfsinnig und mit einem Augenzwinkern erzählt Elisabeth Kabatek von den Herausforderungen der Kehrwoche, einem fast mediterranen Lebensgefühl und von Brezeln, die einfach glücklich machen.
Über Elisabeth Kabatek
Aus „Gebrauchsanweisung für Stuttgart“
Stuttgart
oder: slow love
Heute kann ich es laut sagen. Ich werde dabei nicht rot, senke nicht die Stimme und schäme mich nicht: Ich liebe die Stadt, in der ich seit Ende der Neunzigerjahre lebe. Nicht in jedem Moment und nicht uneingeschränkt. Aber ich möchte nicht mehr weg von hier. Das war nicht immer so.
Stuttgart ist nicht gerade eine Stadt, die die Menschen zum Hyperventilieren bringt. »Neulich war ich in Stuttgart … da ist es vielleicht schön! Diese verwinkelte Altstadt, diese lauschigen Plätze und schnuckeligen Cafés! Was für eine Atmosphäre! Ach, und diese [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Ein gelungener Einblick in die schwäbische Seele, die einige Vorurteile bestätigt, aber auch mit Neuem überrascht. Dazu kommt die lockere Schreibweise der Autorin, die dafür sorgt, dass man nach Verschlingen des Buches am liebsten sofort in die baden-württembergische Hauptstadt am Neckar reisen möchte.“
StadtRadio Göttingen „Book’s n‘ Rock’s“„Eine spannende Lektüre: sowohl für die Einheimischen, die einen neunen Blick auf ihre Heimat gewinnen, als auch für die Reisenden, die an Necker und Nesenbach ein schönes Wochenende verleben wollen.“
Stuttgarter ZeitungInhalt
Stuttgart
oder : slow love
Stuttgart ist viel cooler als Berlin Einstiegshilfe vom Geischt
Ja, wo kehren Sie denn? Klischees über Stuttgart und was an ihnen dran ist
Der große Höhenunterschied macht den
kleinen Unterschied Gebrauchsanweisung für den Kessel Samstagmorgens in der Stadt
Der Nabel der Welt
„To work? I do not have time to work“
Feste und Festivals in Stuttgart
Brezeln machen glücklich
Was man isst, wo man hingeht
Wo der Besen hängt
Zu laut, zu warm, zu gemütlich
Von Bären aller Arten, Wasserfällen mit schwäbischem Understatement und Grünem U
Wohin der Ausflug so gehen kann
„Der Name Stuttgart ist ein magischer Name“
Das Ballettwunder
Oben bleiben, (r)untergehen
oder : Quo vadis, Stuttgart ?
Stuttgart badet in Champagner
Die Mineralbäder
Stuttgart Heilix-Blechle-Stadt
Keine vorübergehende Erscheinung
Mit Dieter und Helmut im Stadion
„ Hey, hey, hey, hey, hey, hey, VfB ein Leben lang “
Dank





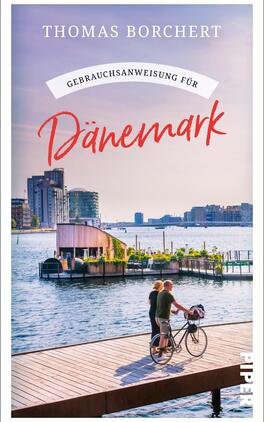
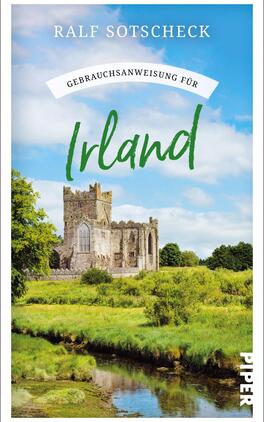
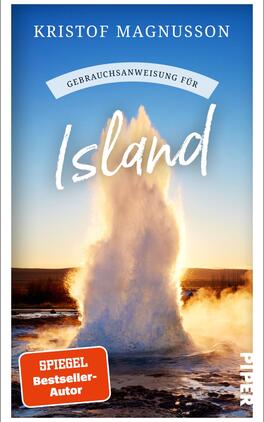
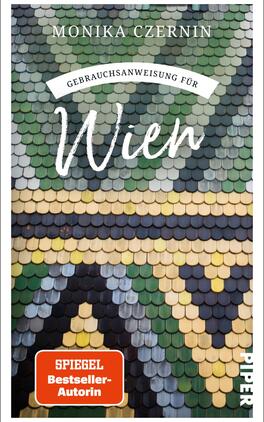
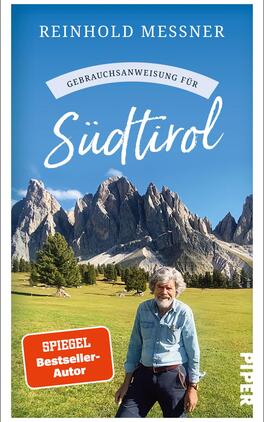
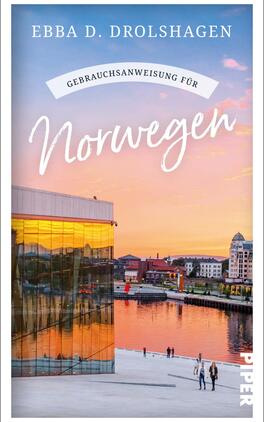
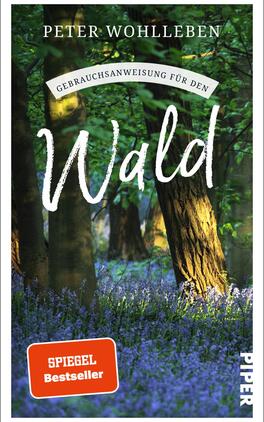
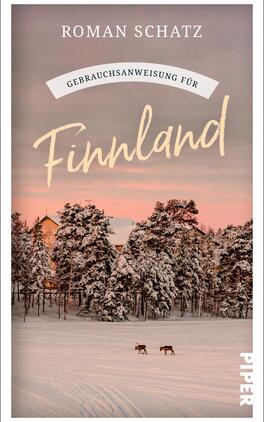
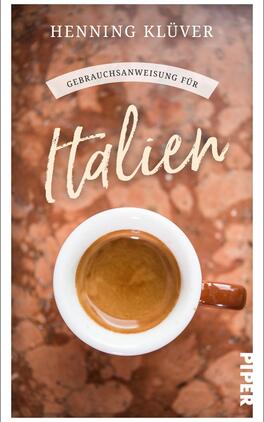
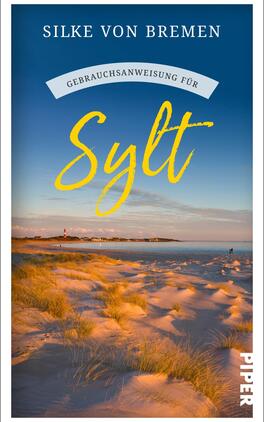
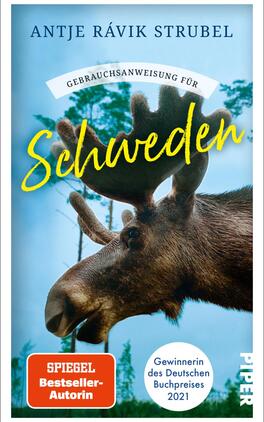
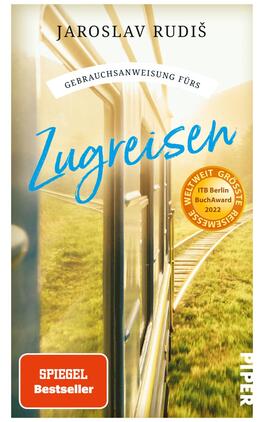



Die erste Bewertung schreiben