Produktbilder zum Buch
Gebrauchsanweisung für Wien
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Eine faszinierende Reise in die ehemalige Kaiserstadt, die so lebendig ist wie nie zuvor.“
Stadtradio GöttingenBeschreibung
Zu Gast in der lebenswertesten Stadt der Welt
Alter Adel und angesagte Clubs, Vorstadtromantik und Boomtownflair, streitbare Intellektuelle und trendige Szenekünstler – Wien hat sich zu einer der coolsten Metropolen weltweit entwickelt. Neben Opernball und traditionellen Kaffeehäusern kann der Besucher in die innovative Musikszene, in Pop-up-Kunstevents und kulinarische Abenteuer eintauchen. Dabei profitiert er von einem nachhaltigen Mobilitätskonzept und originellen Freizeitaktivitäten.
Alles, was man über die Kulturmetropole wissen muss
Monika Czernin führt durch enge Gassen, in den Prater und…
Zu Gast in der lebenswertesten Stadt der Welt
Alter Adel und angesagte Clubs, Vorstadtromantik und Boomtownflair, streitbare Intellektuelle und trendige Szenekünstler – Wien hat sich zu einer der coolsten Metropolen weltweit entwickelt. Neben Opernball und traditionellen Kaffeehäusern kann der Besucher in die innovative Musikszene, in Pop-up-Kunstevents und kulinarische Abenteuer eintauchen. Dabei profitiert er von einem nachhaltigen Mobilitätskonzept und originellen Freizeitaktivitäten.
Alles, was man über die Kulturmetropole wissen muss
Monika Czernin führt durch enge Gassen, in den Prater und ins „rote Wien“, vom Kahlenberg bis in den Wiener Wald. Sie weiß, was den Wiener umtreibt und was den berühmten Schmäh ausmacht. Eine faszinierende Reise in die ehemalige Kaiserstadt, die so lebendig ist wie nie zuvor.
„Die Autorin (...) ist eine exzellente Wien-Kennerin. Charmant führt sie einen durch die prachtvolle Vergangenheit und die spannende Gegenwart - und natürlich in die Kaffeehäuser.“ MERIAN
Über Monika Czernin
Aus „Gebrauchsanweisung für Wien“
Warum ausgerechnet Wien?
Wenn ich an Wien denke, überkommen mich Glücksgefühle, nicht mehr diese urwienerische Melange des Hin-und-hergerissen-Seins zwischen Zugehörigkeit und Fremdheit, zwischen Bleibenwollen oder doch lieber Auswandern. Denn Wien hat sich unangefochten zu einer der coolsten Metropolen weltweit entwickelt. Besonders in Deutschland ist man verwundert: ein zweites Berlin, vielleicht sogar noch besser! Wie Kopenhagen! Umfassende Lebensqualität. Eine sagenhaft gute Lokalszene. Das Wiener Popmusikwunder. Woran liegt es, dass Wien kurzerhand alle [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Warum ausgerechnet Wien?
Ankommen im Herzen von Wien
Wo, bitte, ist Ihr „Kaffeezuhaus“?
Einmal um die Ringstraße
Das rote Wien
Der Prater und das jüdische Wien
Alles Walzer!
Schein und Sein
Kunst oder die Steine des Anstoßes
Eine Bühne des Lebens
Wien und der Osten
Wien und die Türken
Wien und sein Grün
Krank sein, sterben und auferstehen
Wehmut by night
Dank

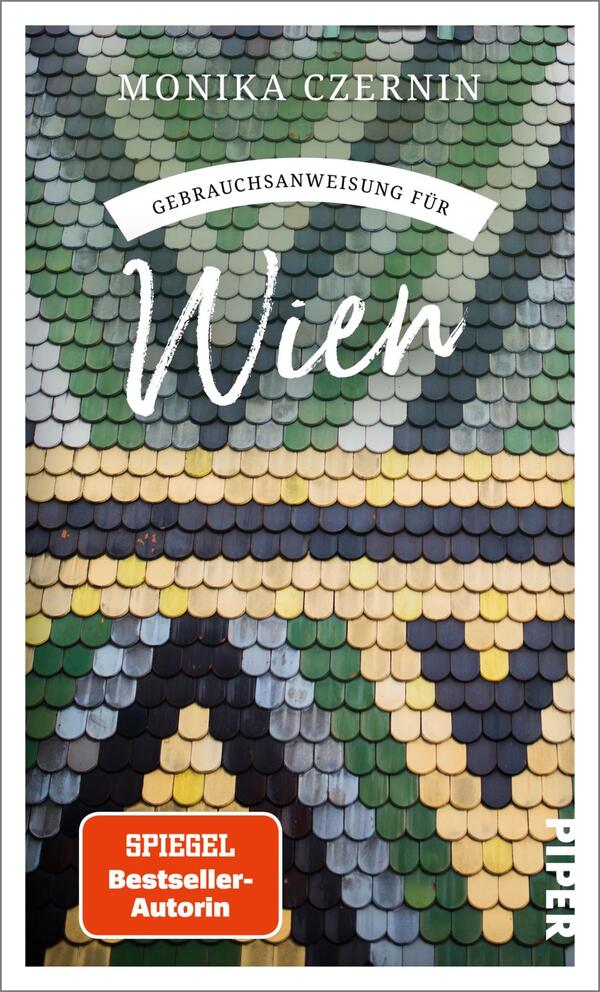
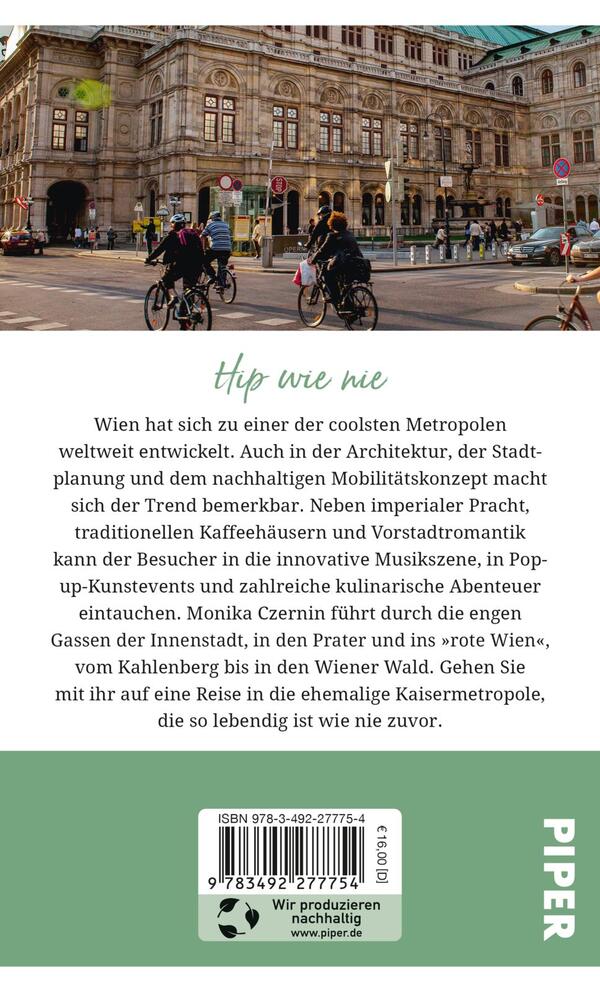
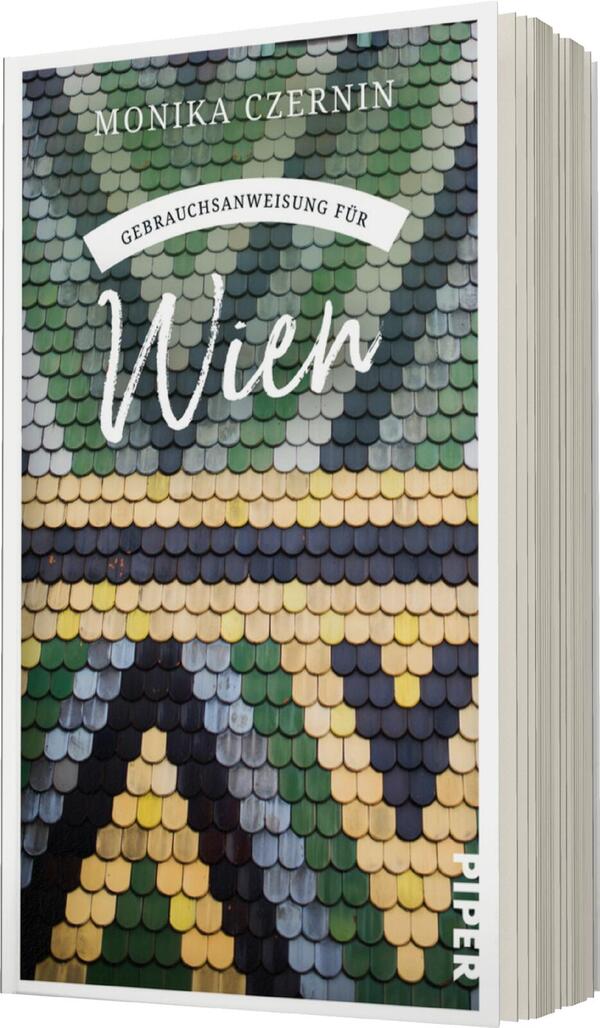
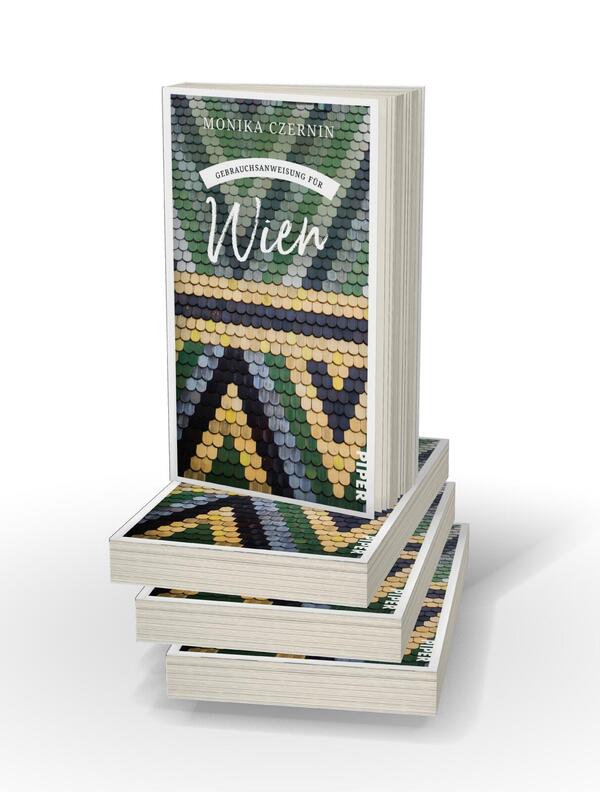
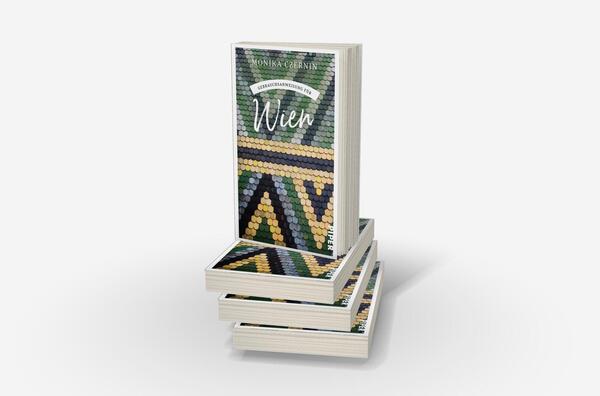
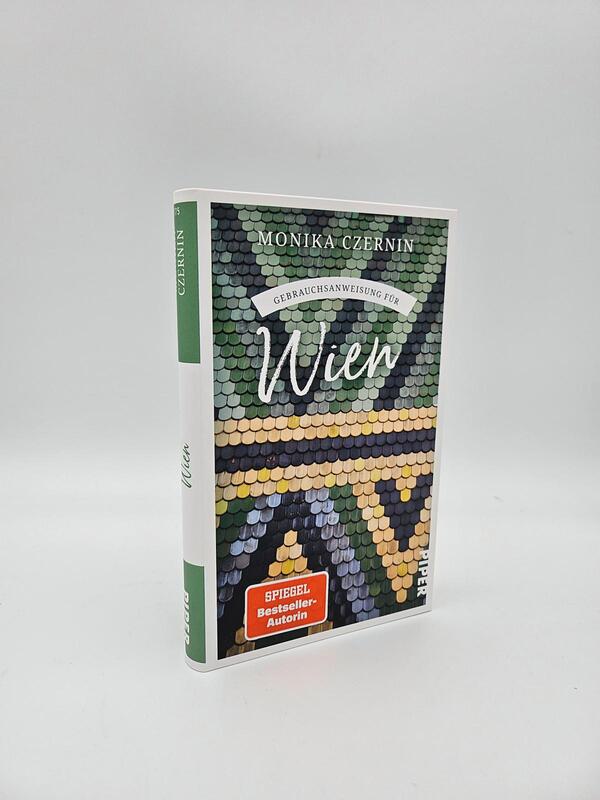

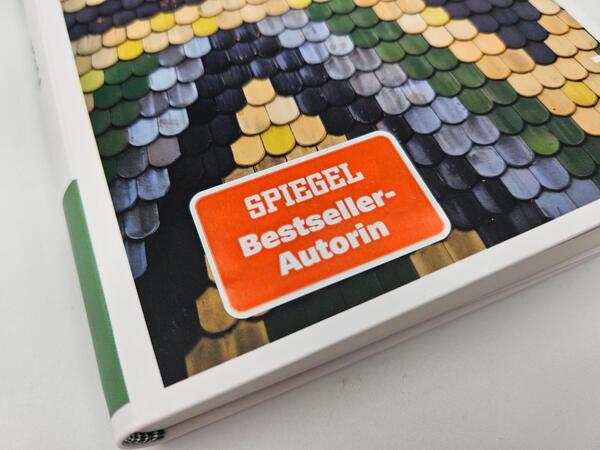
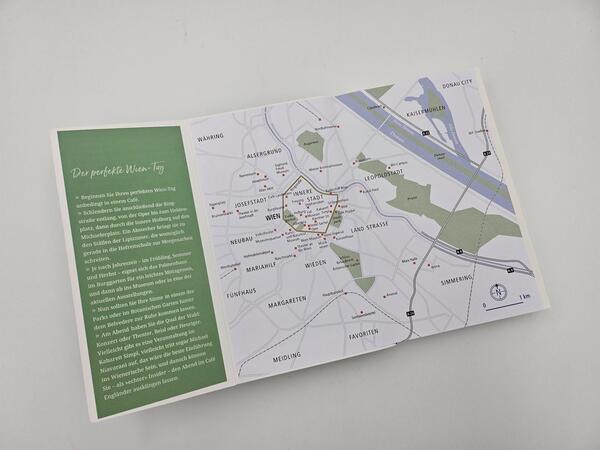
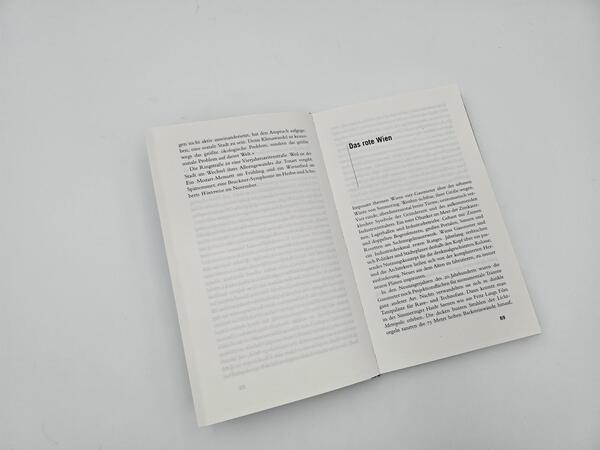





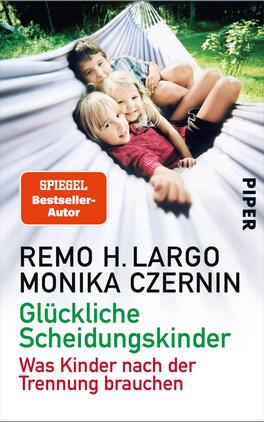
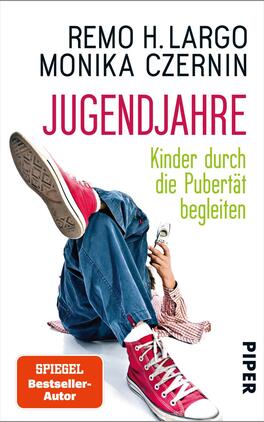
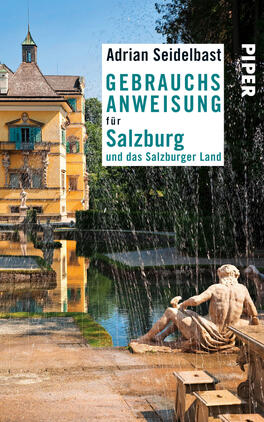
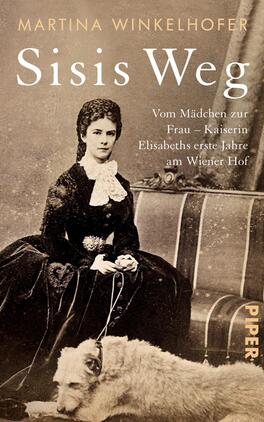
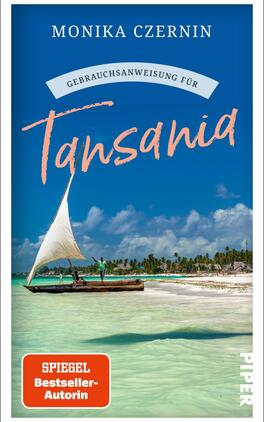
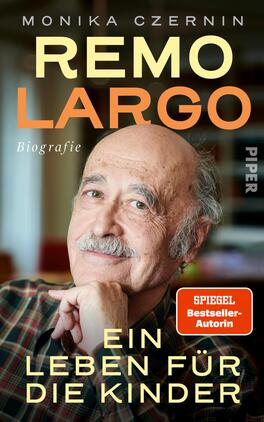
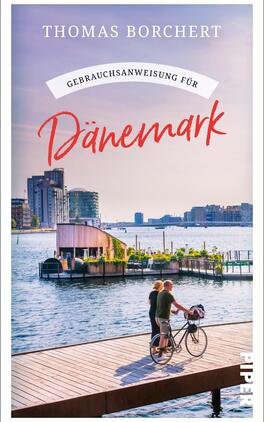
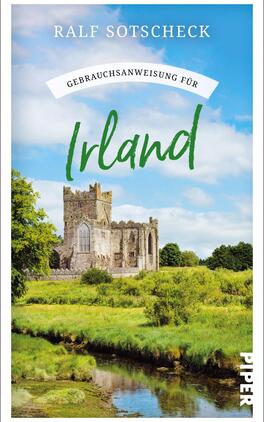
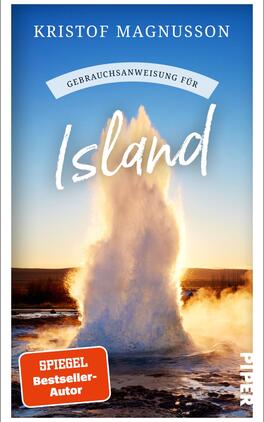
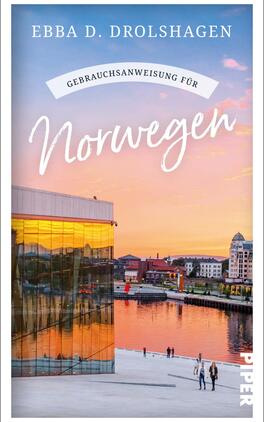
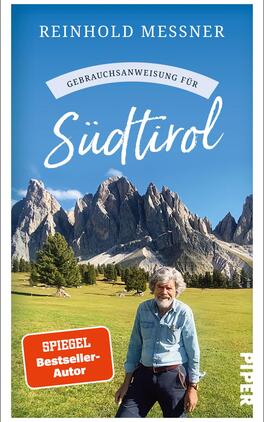
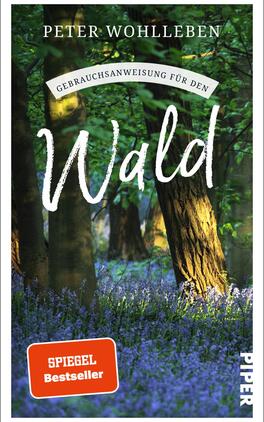

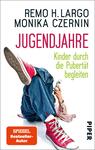

Die erste Bewertung schreiben