Produktbilder zum Buch
Gebrauchsanweisung für den Wald
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Unterwegs mit Deutschlands beliebtestem Förster
Peter Wohlleben nimmt Sie mit auf eine einmalige Entdeckungstour in unsere heimischen Wälder. Fundiert und anschaulich erzählt der Bestsellerautor vom Wald und seinen Bewohnern, vom Lesen spannender Tierspuren und von Bäumen, die Klimakrise und Borkenkäfern trotzen.
„Wohlleben hat dem Wald die Seele zurückgegeben.“ Süddeutsche Zeitung
Er beschreibt, wie ein Waldspaziergang zu jeder Zeit und für die ganze Familie zum Highlight wird – egal, ob Sie im Februar, Mai, August oder November unterwegs sind. Und erklärt, wie Sie ohne Kompass und GPS…
Unterwegs mit Deutschlands beliebtestem Förster
Peter Wohlleben nimmt Sie mit auf eine einmalige Entdeckungstour in unsere heimischen Wälder. Fundiert und anschaulich erzählt der Bestsellerautor vom Wald und seinen Bewohnern, vom Lesen spannender Tierspuren und von Bäumen, die Klimakrise und Borkenkäfern trotzen.
„Wohlleben hat dem Wald die Seele zurückgegeben.“ Süddeutsche Zeitung
Er beschreibt, wie ein Waldspaziergang zu jeder Zeit und für die ganze Familie zum Highlight wird – egal, ob Sie im Februar, Mai, August oder November unterwegs sind. Und erklärt, wie Sie ohne Kompass und GPS navigieren, sich ganz natürlich gegen Mücken schützen und was wir vom Wald für die Zukunft lernen können. Denn wer die Grundlagen von Klima- und Naturschutz verstehen will, sollte Zeit im Wald verbringen.
„Wohlleben macht mit dem Buch Appetit auf das Wunder Wald.“ Donaukurier
Peter Wohlleben wollte schon als kleines Kind Naturschützer werden, er studierte Forstwirtschaft und leitet heute einen umweltfreundlichen Forstbetrieb und eine Waldakademie in der Eifel. In seinen Vorträgen, Podcasts und Naturführungen findet er immer wieder neue Zugänge, die das große Thema Naturschutz zu einem Anliegen für jeden Einzelnen von uns machen.
Über Peter Wohlleben
Aus „Gebrauchsanweisung für den Wald“
Eine Gebrauchsanweisung für den Wald?
Eine Gebrauchsanweisung für den Wald ist heute nicht mehr ganz so einfach zu schreiben wie noch vor einigen Jahren für die erste Auflage dieses Buches. Inzwischen hat der Klimawandel zugeschlagen, und mancherorts, wie beispielsweise im Sauerland oder im Harz, gleichen ehemalige Waldflächen eher Mondlandschaften. Tote und umstürzende Bäume, Brandgefahr und Tristesse – wie soll man damit als Waldbesucherin oder -besucher umgehen? Gibt es sie noch, die kleinen Freuden unter schattigen Buchen und Eichen? Selbstverständlich! Und es [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Eine Gebrauchsanweisung für den Wald ?
Querfeldein
Auf Spurensuche
Tiere beobachten
Ab in die Pilze!
Frisch gewaschen und – zerstochen
Zeckenalarm
Waidmannsheil
Von Tollwut und Würmern
Rotkäppchen lässt grüßen
Bestimmungsbuch ohne Staub
Ist es wirklich Liebe?
Kleines Wörterbuch Deutsch–Forstwirtschaft
Die Holzhackerbuam
Naturschutz versus Artenschutz
Blitz und Donner
Das Glasscherben-Märchen
Ohne Uhr und ohne Kompass
Überleben im Wald
Wenn der Förster zum Bestatter wird
Darf der das?
Nachts unterwegs
Dresscode
Der Wald bei uns zu Hause
Waldspaziergang im Februar
Waldspaziergang im Mai
Waldspaziergang im August
Waldspaziergang im November
Mit Kindern unterwegs
Klimakrise und Waldsterben
Zum Schluss
Quellenverzeichnis

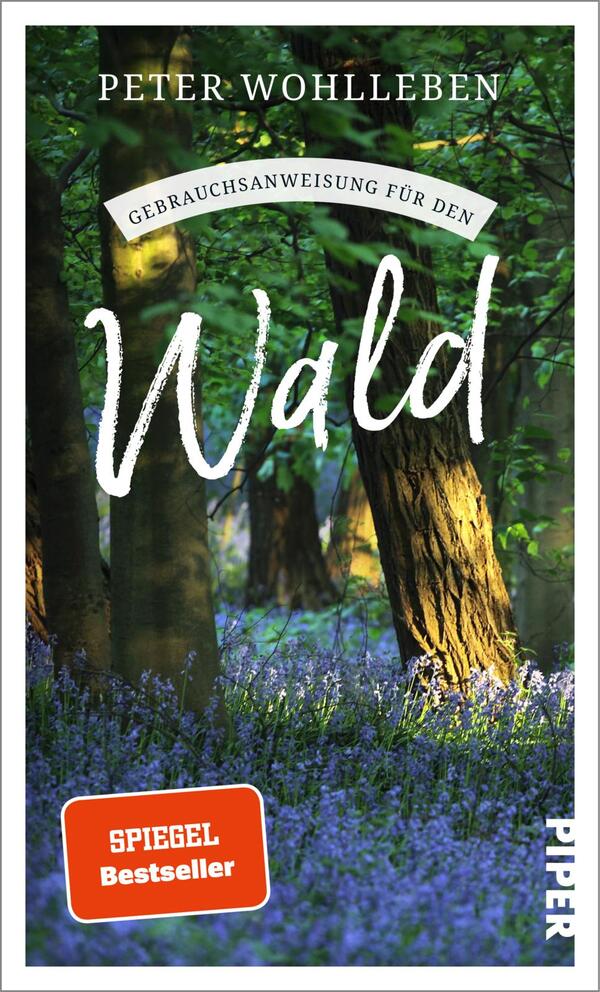
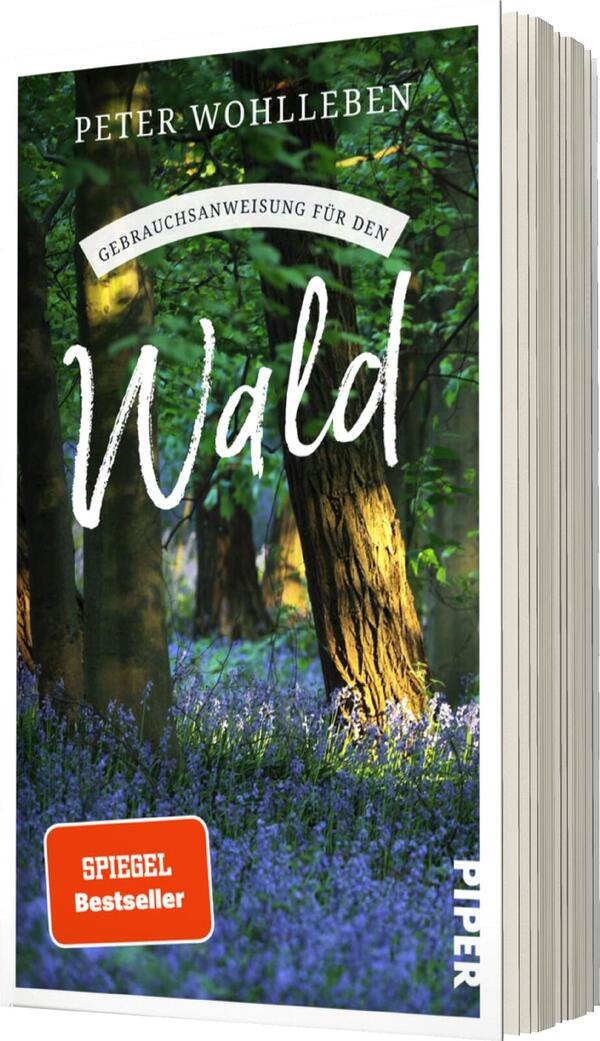
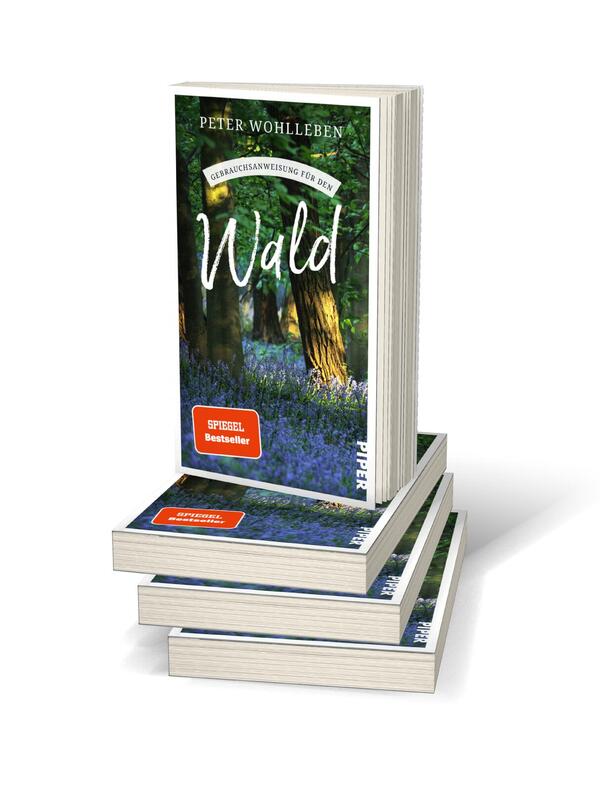
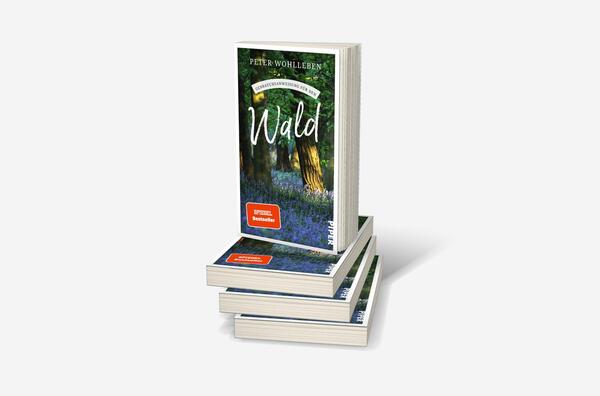

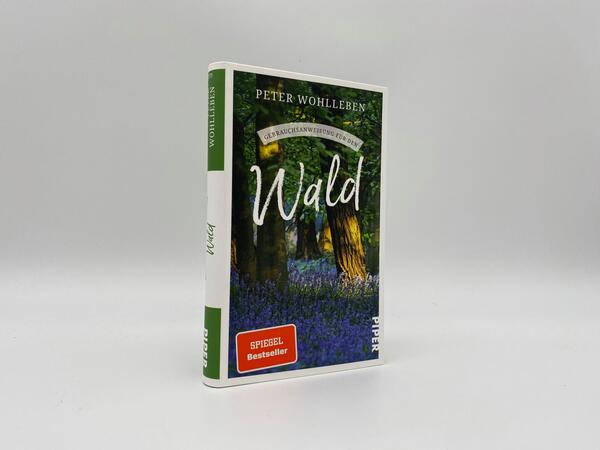








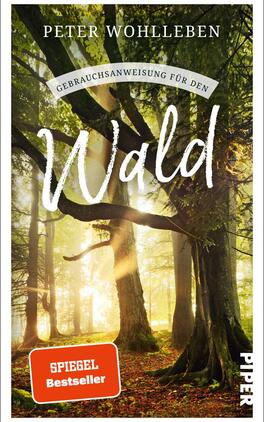




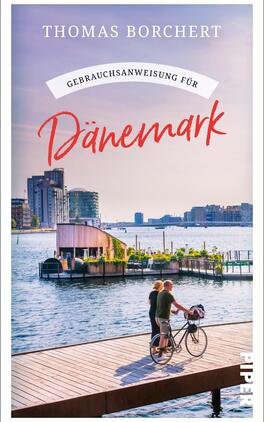
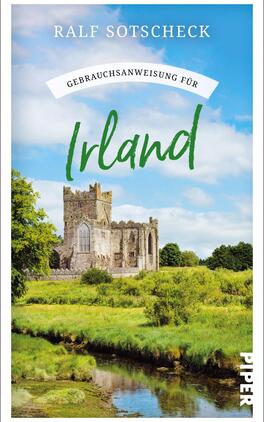
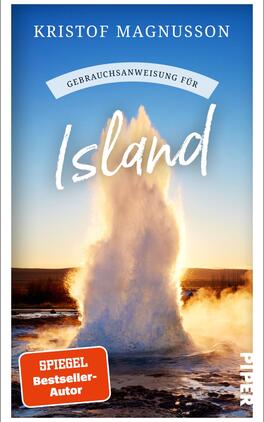
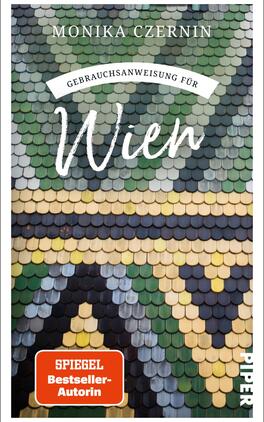

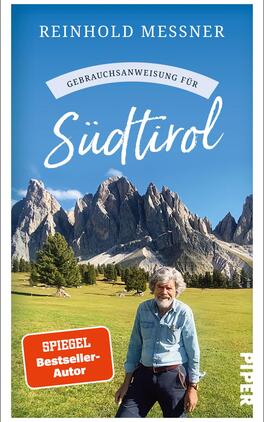
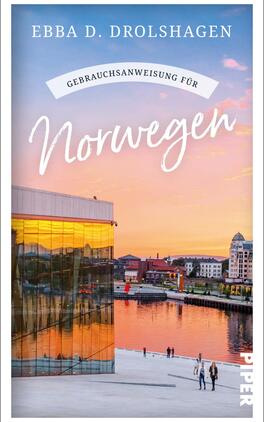



Bewertungen
Kalorienvergleich Walfleisch - Mais
Hallo,
ich lese gerade die aktualisierte und erweiterte Neuauflage des Buches von 2023 und bin im Kapitel "Waidmannsheil" über die Aussage des Kaloriengehalts von Mais und Walfleisch gestolpert. Ich denke der Vergleich hinkt etwas - hier wird trockener Mais oder Maismehl mit frischem Flei…
Hallo,
ich lese gerade die aktualisierte und erweiterte Neuauflage des Buches von 2023 und bin im Kapitel "Waidmannsheil" über die Aussage des Kaloriengehalts von Mais und Walfleisch gestolpert. Ich denke der Vergleich hinkt etwas - hier wird trockener Mais oder Maismehl mit frischem Fleisch verglichen. Nur durch den Unterschied im Wassergehalt ergibt sich der große Kalorienunterschied. Es wird ja kaum jemand trockenes Maismehl zu sich nehmen. Hier wäre ein Vergleich mit Gemüsemais oder mit getrocknetem Fleisch sinnvoller. Allerdings wird der Kalorienvergleich dann ganz anders ausfallen.
Ich hoffe dennoch, dass diese Fehlinterprätation bei der nächsten Auflage korrigiert wird.
Mit freundlichen Grüßen
Petra Müller