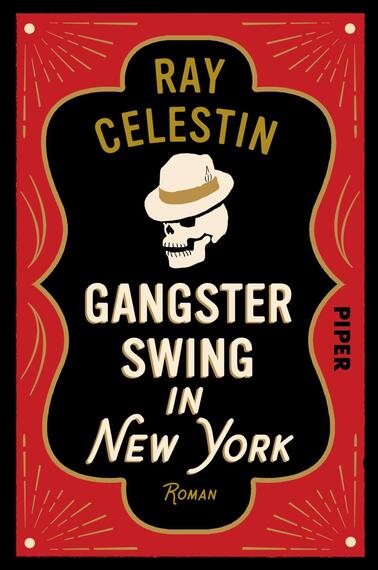
Gangsterswing in New York (City-Blues-Reihe 3) - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
New York 1947. Gabriel, der Manager des berüchtigten Copacabana-Clubs, plant seit Jahren seinen Ausbruch aus dem unerbittlichen Griff der Mafia. Er will seinen eigenen Tod vortäuschen und nach Mexiko verschwinden. Doch zehn Tage vor seiner geplanten Flucht stellt Mafiaboss Costello ihm eine schier unmögliche Aufgabe: Entweder Gabriel spürt zwei Millionen Dollar wieder auf, die dem Herrscher der Unterwelt gestohlen wurden, oder er wird bis an sein Lebensende gejagt. Auch Privatdetektivin Ida kommt nach New York, um ihrem ehemaligen Partner Michael Talbot zu helfen: Sein Sohn Thomas wurde wegen…
New York 1947. Gabriel, der Manager des berüchtigten Copacabana-Clubs, plant seit Jahren seinen Ausbruch aus dem unerbittlichen Griff der Mafia. Er will seinen eigenen Tod vortäuschen und nach Mexiko verschwinden. Doch zehn Tage vor seiner geplanten Flucht stellt Mafiaboss Costello ihm eine schier unmögliche Aufgabe: Entweder Gabriel spürt zwei Millionen Dollar wieder auf, die dem Herrscher der Unterwelt gestohlen wurden, oder er wird bis an sein Lebensende gejagt. Auch Privatdetektivin Ida kommt nach New York, um ihrem ehemaligen Partner Michael Talbot zu helfen: Sein Sohn Thomas wurde wegen eines brutalen Vierfachmordes angeklagt. Ida und Michael wissen, dass Thomas unschuldig sein muss, doch offenbar verschweigt er ihnen etwas …
Weitere Titel der Serie „City-Blues-Reihe“
Über Ray Celestin
Aus „Gangsterswing in New York (City-Blues-Reihe 3)“
Sunday News
~ New York’s Picture Newspaper ~
City Edition Final
Sonntag, 3. August 1947
Lokalnachrichten
Haus des Grauens in Harlem
Vier Menschen in Absteige in Uptown Manhattan getötet
Schwarzer Veteran am Tatort verhaftet
Brutale Ermordung steht im Zusammenhang mit Voodoo
Leonard Sears – Leitender Kriminalreporter
Manhattan, 2. August – Nach einer Mordserie am späten Freitagabend in einem Hotel an der West 141st Street wurde Thomas James Talbot, 35, Mitarbeiter im New York City Hospital, heute Morgen des vorsätzlichen Mordes in vier Fällen angeklagt. Die Polizeibeamten, [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
Teil 7
Teil 8
Teil 9
Teil 10
Teil 11
Teil 12
Teil 13
Teil 14
Teil 15
Teil 16
Teil 17
Teil 18
Teil 19
Teil 20
Nachwort
Personenverzeichnis



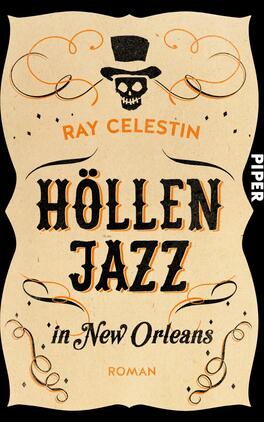
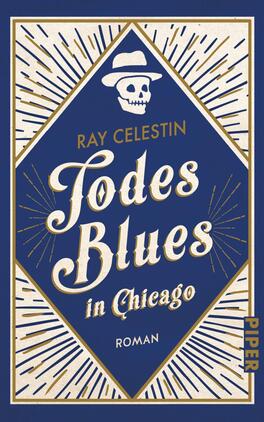
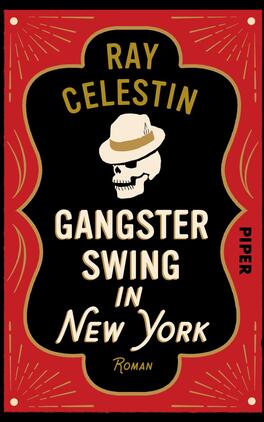

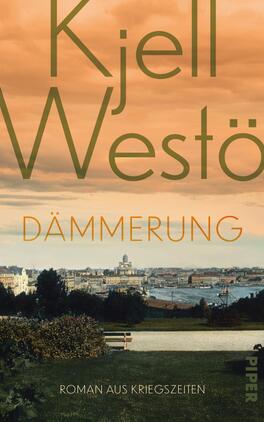
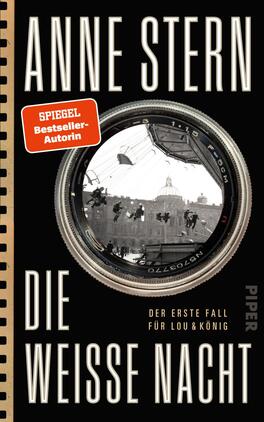




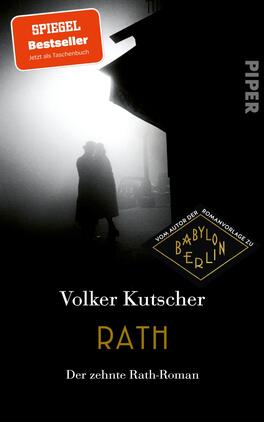



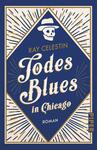


Die erste Bewertung schreiben