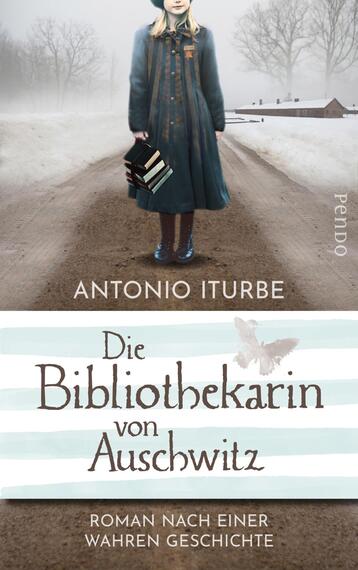
Die Bibliothekarin von Auschwitz - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Ein Ort des Schreckens. Acht Bücher, die alles ändern.
Im alles verschlingenden Morast des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau hat der Blockälteste Fredy Hirsch heimlich eine Schule aufgebaut. Ihr wertvollster Besitz sind acht alte, zerfallene Bücher. Fredy ernennt die 14-jährige Dita zur Bibliothekarin, sie soll die verbotenen Bände künftig verstecken und schützen. Dita, die schon früher Trost in Büchern gefunden hat, kümmert sich mit äußerster Hingabe um „ihre“ kleine Bibliothek. Und die Bücher geben zurück: Sie schenken Licht, wo nur noch Dunkelheit zu sein scheint, und bieten einen…
Ein Ort des Schreckens. Acht Bücher, die alles ändern.
Im alles verschlingenden Morast des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau hat der Blockälteste Fredy Hirsch heimlich eine Schule aufgebaut. Ihr wertvollster Besitz sind acht alte, zerfallene Bücher. Fredy ernennt die 14-jährige Dita zur Bibliothekarin, sie soll die verbotenen Bände künftig verstecken und schützen. Dita, die schon früher Trost in Büchern gefunden hat, kümmert sich mit äußerster Hingabe um „ihre“ kleine Bibliothek. Und die Bücher geben zurück: Sie schenken Licht, wo nur noch Dunkelheit zu sein scheint, und bieten einen Anker, wo der Schmerz zu übermannen droht. Die Bücher begleiten Dita und die anderen Häftlinge durch die Zeiten der größten Verzweiflung, bis wieder ein neuer Hoffnungsschimmer zu erkennen ist.
Eine ergreifende Auschwitz-Geschichte über die Magie der Bücher, erzählt nach einer wahren Begebenheit.
Über Antonio Iturbe
Das könnte Ihnen auch gefallen
Würden Sie „Die Bibliothekarin von Auschwitz“ in drei Sätzen für uns beschreiben?
Der Häftling Fredy Hirsch wurde von der Lagerleitung des KZ Auschwitz-Birkenau beauftragt, in Baracke 31 einen Ort zu schaffen, an dem die Kinder beschäftigt werden konnten, während ihre Eltern arbeiten mussten. Es wurde ihm verboten, sie zu unterrichten, über Religion oder Politik zu sprechen. Aber Hirsch hört nicht auf sie. Er organisierte eine kleine Schule im Untergrund und suchte acht alte Bücher auf dem Schwarzmarkt im Lager zusammen, wodurch die Baracke eine hinsichtlich der Anzahl der Exemplare winzige Bibliothek erhielt, und machte ein 14-jähriges Mädchen namens Edita für diese empfindlichen Bücher verantwortlich.
Wie wurden Sie auf die Geschichte von Dita Kraus aufmerksam?
Ich bin kein Experte für den Zweiten Weltkrieg, aber ich arbeite seit Jahren in Literaturmagazinen und lese viel über die Geschichte des Lesens. Durch die Lektüre eines Werkes von Alberto Manguel, einem der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der Geschichte des Buches, hörte ich zum ersten Mal von der Existenz der kleinen Bibliothek in der geheimen Schule im Lager BIIb in Auschwitz. Durch die angegebenen Quellen wurde ich auf Nili Keren, eine Expertin für den Holocaust, aufmerksam. In einem ihrer Aufsätze geht sie ausführlicher auf die Baracke 31 in Auschwitz und auf deren Bücher ein. Dort las ich auch zum ersten Mal, dass das Mädchen, das sich um die Bücher im Lager kümmerte, Edita hieß.
Wie haben Sie die Holocaust-Überlebende Dita Kraus ausfindig gemacht? Stand sie der Idee eines Buches über ihre eigene Geschichte offen gegenüber?
Auf der Suche nach Hinweisen stieß ich auf das Unerwartete: Dita Kraus selbst, die sich um diese Bücher gekümmert hatte. Als ich ihr zum ersten Mal sagte, dass ich ein spanischer Journalist und Schriftsteller sei und dass ich mich sehr für ihre Geschichte interessiere, war sie etwas perplex: Sie erzählte mir, dass sie nichts Besonderes getan habe, dass man ihr die Bücher gegeben habe, um sie an die Schüler und Lehrer auszugeben und am Ende des Tages einzusammeln, dass sie, wenn man ihr einen Besen gegeben hätte, gefegt hätte, dass sie nur das getan hätte, worum Fredy Hirsch sie gebeten hatte. Aber als ich auf meinem Interesse bestand, war sie sehr hilfsbereit, und nach und nach freundeten wir uns an. Sie fand es gut, dass ich schrieb, was ich schreiben wollte, solange ich dabei diejenigen respektierte, die haben leiden müssen.
Wie oft haben Sie sich während der Arbeit am Roman mit ihr getroffen?
Ich schrieb dieses Buch über fast fünf Jahre hinweg. Es gab Zeiten, in denen wir uns häufig schrieben, aber auch eine Zeit, in der sie ihren E-Mail-Anbieter wechselte, und ich etwa ein Jahr lang den Kontakt verlor, bis Dita eines Tages wieder in meinem Postfach auftauchte, weil es ihr endlich gelungen war, meine Mailadresse ausfindig zu machen. Persönlich trafen wir uns zum ersten Mal in Prag, und ich nahm ein paar Interviews auf. Meine Arbeit bei einer Zeitschrift, der Unterricht an der Universität und die familiären Verpflichtungen führten dazu, dass ich mir für das Schreiben des Romans nach dem Zufallsprinzip Zeit zusammenklauben musste, und es gab weder ein festgelegtes Vorgehen noch irgendeine Regelmäßigkeit beim Schreiben. Die Dinge geschahen einfach in der Geschwindigkeit des Lebens selbst.
Was war die größte Herausforderung beim Schreiben Ihres Romans? Und was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?
Die Herausforderung besteht immer darin, dieses Wunschkonzert, das in deinem Kopf mit einer Bandbreite von einer Million Tönen, Farben, Schattierungen und Emotionen herrlich klingt, auf die flache Dimension eines Papiers in schwarz-weißer Schrift zu übertragen. Virginia Woolf verglich es mit der Wasserentnahme aus einem Brunnen. Schreiben ist wie einen Eimer auf den Boden eines Brunnens zu werfen, in der Hoffnung, dass er, wenn er wieder hochkommt, mit frischem Wasser gefüllt ist. Aber er kommt fast immer leer wieder heraus. Wenn jedoch auch nur ein paar Fingerbreit frisches Wasser darin herumplätschern, wenn es einen Textabschnitt gibt, von dem man glaubt, dass das innere Licht nach außen dringt, dann rechtfertigt dieser Moment die ständigen Niederlagen eines Autors.
Wie viel haben Sie in der Geschichte selbst erfunden, wie viel ist tatsächlich passiert?
Wie viel tatsächlich passiert ist, weiß niemand. Dies ist keine Biographie, sondern ein Roman. Dita Kraus selbst hat gerade ihre Memoiren geschrieben, und das ist natürlich tatsächlich eine richtige Autobiographie. Ich habe „Die Bibliothekarin von Auschwitz“ auf der Grundlage der Fakten geschrieben, die Dita Kraus mir erzählt hat, die ich in mehr als dreißig Büchern gelesen habe und die sich in meinem Kopf mit dieser stroboskopartigen Genauigkeit von Träumen offenbart haben. In diesem Buch gibt es sowohl Fakten als auch ein Abbild meines eigenen Blickwinkels, der sicher so verzerrt ist wie der von Don Quijote. Aber für mich ist dieses Buch Wirklichkeit. Selbst die Dialoge, die ich nicht hören und wiedergeben konnte, die Blicke, die ich nicht sah, die Nebenfiguren, die ich hinzugefügt habe, die Bücher, die mit der Zeit vergessen wurden, die ich wieder in die kleine, geheime Bibliothek gestellt habe – für mich gibt es daran nichts Unechtes. Während ich schrieb, lebte das alles in mir.
Haben Sie bestimmte Schreibgewohnheiten? In welcher Umgebung schreiben Sie am liebsten? Im Stillen oder mit Musik? Auf dem Computer oder auf Papier?
Ich habe keine festen Schreibzeiten, ich glaube nicht, dass dies ein Bürojob ist. Ich habe immer ein Notizbuch auf meinem Nachttisch liegen, um die Ideen, die vom Boden des Brunnens kommen, handschriftlich zu notieren, aber normalerweise schreibe ich viel am Computer. Wenn ich zu Hause bin, habe ich vor dem Schreiben das kleine Ritual, mir eine Tasse Tee zu machen. Es geht mir dabei nicht so sehr um den Tee, sondern vielmehr um die Zubereitung des Aufgusses selbst: das Wasser erhitzen, ihm beim Kochen zusehen, die Teeblätter aus der Dose nehmen, die in der Küche den Duft entlegener Landschaften verströmen ... Manchmal lasse ich den Tee auf dem Tisch stehen, beginne zu schreiben und vergesse, ihn zu trinken. Das sind die besten Tage.
Wie erklären Sie sich den internationalen Erfolg von „Die Bibliothekarin von Auschwitz“?
Ich habe mich sehr über die Auszeichnung als bestes übersetztes Buch des Jahres durch die japanischen Leser gefreut. Ein Ort, der mir so weit weg schien, und doch waren wir uns in unseren Emotionen so nahe. Egal wie sehr der Nationalismus versucht, Volksstämme zu schaffen, wir Menschen sind uns viel ähnlicher, als wir denken, und wir fühlen uns verwundbar: Uns schmerzen die gleichen Dinge, wir leiden unter den gleichen Missständen, wir haben die gleichen Sorgen.




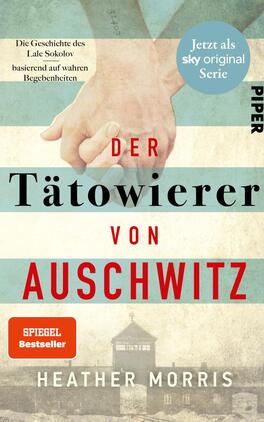
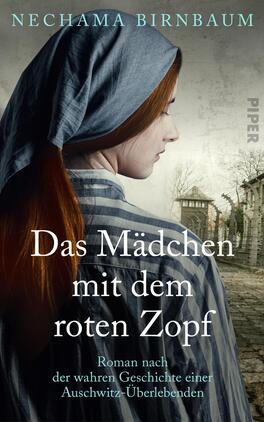
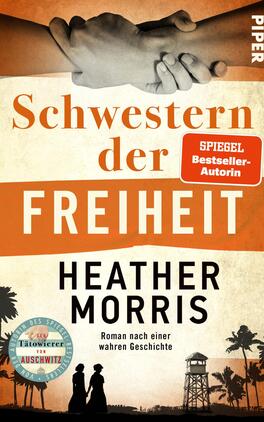
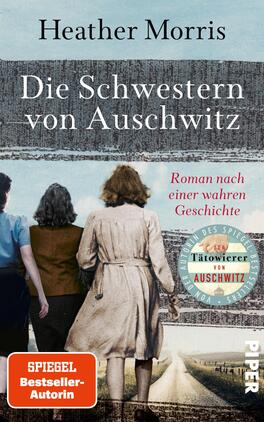
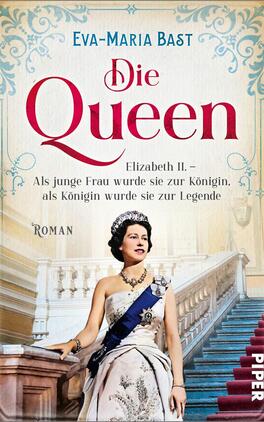
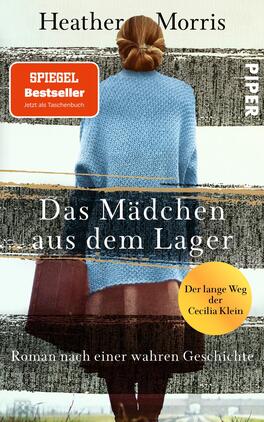
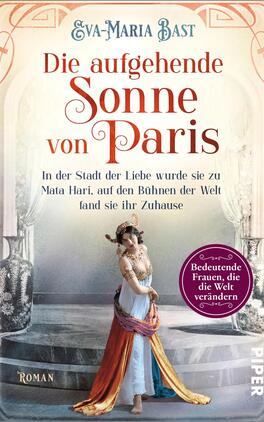
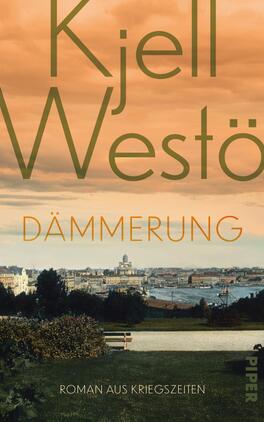
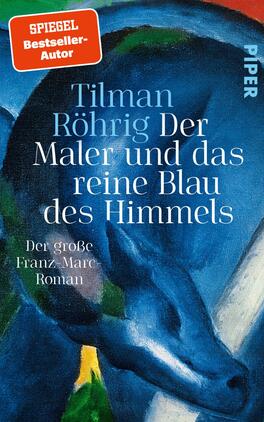
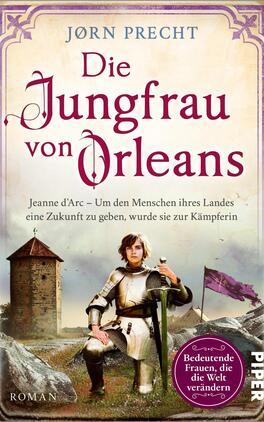
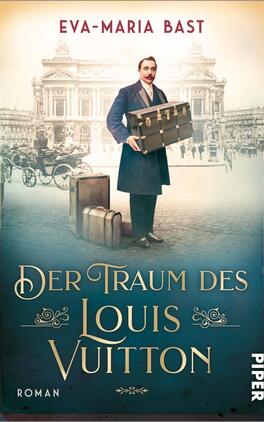
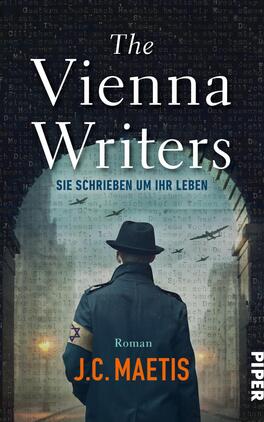
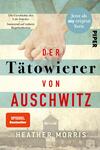
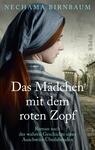
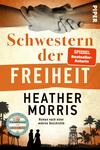
Die erste Bewertung schreiben