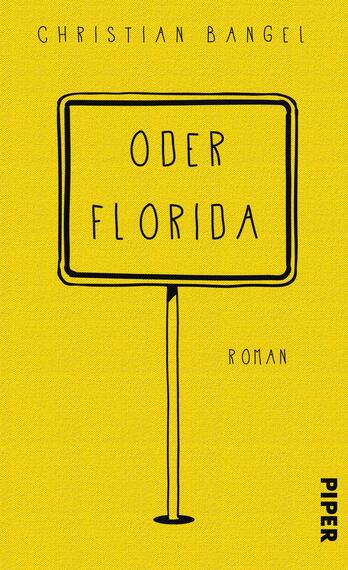
Oder Florida - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Wer begreifen möchte, woher das derzeit diskutierte Abständige zum Gesamtdeutschen vieler Ostdeutscher rührt, sollte Bangels Coming-of-Age-Roman ›Oder Florida‹ lesen.“
tazBeschreibung
Man kann alles erreichen, wenn man nur will - daran würde Matthias Freier, 20, so gerne glauben. Aber wenn er im Jahr 1998 in seiner Platte sitzt und auf seine Heimatstadt Frankfurt (Oder) blickt, weiß er nicht recht: Ist das der wilde Osten der unbegrenzten Möglichkeiten oder nur eine öde Brache, die fest in der Hand der Angst und Schrecken verbreitenden Nazis ist? Freiers Kumpel Fliege hat sich entschieden, sein und Freiers Schicksal in die Hand zu nehmen. Der Plan: die Frankfurter SPD durch organisierten Masseneintritt übernehmen. Das Wahlprogramm: endlich besseres Wetter für Frankfurt. Zur…
Man kann alles erreichen, wenn man nur will - daran würde Matthias Freier, 20, so gerne glauben. Aber wenn er im Jahr 1998 in seiner Platte sitzt und auf seine Heimatstadt Frankfurt (Oder) blickt, weiß er nicht recht: Ist das der wilde Osten der unbegrenzten Möglichkeiten oder nur eine öde Brache, die fest in der Hand der Angst und Schrecken verbreitenden Nazis ist? Freiers Kumpel Fliege hat sich entschieden, sein und Freiers Schicksal in die Hand zu nehmen. Der Plan: die Frankfurter SPD durch organisierten Masseneintritt übernehmen. Das Wahlprogramm: endlich besseres Wetter für Frankfurt. Zur Sonne, zur Freiheit! Christian Bangel hat einen so humorvoll-nostalgischen wie scharfsichtig-visionären Roman geschrieben – denn wir alle sind Freier, und dabei doch kein bisschen frei.
Über Christian Bangel
Aus „Oder Florida“
Frankfurt (Oder)
Langsam wurde es peinlich. Zehn Fragen hatte ich auf dem Zettel, sieben hatte ich schon gestellt, nur drei hatte sie beantwortet. Wobei eine davon die gewesen war, wie es ihr gehe. Dieses große Interview, das ich all meinen Bekannten lange angekündigt hatte, es entwickelte sich zu einer riesigen Pleite.
Flieges Plan war eigentlich nicht schlecht gewesen: die bekannteste Frau Deutschlands, auf ihre subversive Art subversiv, Pornografie als stumme Selbstverständigung der Mettbrötchen-Deutschen. Das klang gut, wenn man es von Fliege hörte, der, Füße [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Grauer Beton und Nazis im Osten, Kapitalismus und Vorurteile im Westen - all das kommt in Bangels Roman vor. Stereotyp oder herablassend wirkt es trotzdem nicht. Die Coming-of-Age-Thematik, aber auch der lässige Sound, gepaart mit Witz und Chuzpe, erinnert an André Kubiczeks ›Skizze eines Sommers‹.“
sueddeutsche.de„Ein amüsanter Bildungsroman.“
rbb - Antenne Brandenburg„›Oder Florida‹ (…) ist witzig und tragisch, nachdenklich und lässig, gefühlvoll und komisch. Ein Bildungsroman, ein Wenderoman, ein Frankfurt/Oder-Roman, ein Liebesroman, ein Zeitroman.“
literaturreich.wordpress.com„Einfach nur herrlich, nämlich herrlich schräg, dieses Lesevergnügen!“
literaturmarkt.info„Oder Florida ist ein Buch über das Deutschland nach der Wende – witzig-melancholisch und mit einem zeitlichen Abstand geschrieben, der es erlaubt, inzwischen auch die tragischen Momente des ersten Jahrzehnts nach der deutschen Wiedervereinigung mit zumindest einem lachenden Auge zu sehen.“
literaturkritik.de„Der Debütant ist ein versierter Erzähler, der einen sympathischen Helden erfunden hat.“
Wilhelmshavener Zeitung„Das ist traurig. Das ist komisch. Das ist politisch und satirisch und realistisch und irrwitzig und abenteuerlich und großartig. Der 1979 in Frankfurt/Oder geborene Bangel hat eines der stärksten Debüts der vergangenen Jahre verfasst.“
Westfalenpost„Ein witzig-lakonisches, zeitkritisches, furioses Debüt.“
Südwest PresseJurybegründung: „Der Roman ›Oder Florida‹ von Christian Bangel ist ein grandioser Unterhaltungsroman – und noch mehr als das. Es ist ein Roman voller Humor, der manchmal bitter schmeckt. Klug verweist der Autor mit seinem Plot auf aktuelle Ereignisse, Entwicklungen und Tendenzen in Politik und Gesellschaft ohne der Gefahr zu erliegen, die Moralkeule zu schwingen. Er wirft einen scharfen, oftmals schmerzhaften Blick auf das Leben und die Menschen in Ost- und Westdeutschland.“
Shortlist von „Das Debüt 2017“„›Oder Florida‹ ist ein lesenswertes Kapitel deutscher Geschichte.“
RBB Stilbruch„›Oder Florida‹ ist nicht nur als Debüt ein bemerkenswerter Roman. Es ist weder ein Ostbuch noch ein Westbuch.( …) Das Buch will nicht Partei sein im Zwist um die Deutungshoheit. Es will sich keinem anempfehlen, sondern einfach nur wahrgenommen werden. Andere gehen dafür auf die Straße. Bangel schreibt sein Buch. Beim Lesen ist es irgendwann einfach zu schnell zu Ende. Danach fasst sich der Westen ein bisschen anders an und der Osten auch, die Vergangenheit und die Gegenwart.“
Neues Deutschland„Zum Besten an diesem Roman gehört der Witz, den Bangel trotz des mitunter deprimierenden Sujets in einer Wende-verwundeten Stadt unterbringt.“
Märkische Oderzeitung„Unterhaltsam und ungekünstelt erzählt Christian Bangel von den bewegten Jahren nach dem Mauerfall, in denen im wilden Osten so vieles möglich schien. Der Roman versucht nicht witzig zu sein, sondern liest sich wohltuend authentisch.“
Märkische Allgemeine„Mit ›Oder Florida‹ arbeitet der selbst aus Frankfurt (Oder) stammende Autor Christian Bangel nicht nur ostdeutsche Lebenswege auf, sondern erkundet sein eigenes ambivalentes Verhältnis zu seiner Heimat der Neunziger.“
Die Zeit im Osten„Bangel schreibt dinglich und belebt, stellenweise auch sehr komisch. Eine Zeit und ein Lebensgefühl werden lebendig, es ist die Stimmung derjenigen, die im Wendejahr im Osten Deutschlands Kind waren.“
Deutschlandfunk - Büchermarkt„Wer begreifen möchte, woher das derzeit diskutierte Abständige zum Gesamtdeutschen vieler Ostdeutscher rührt, sollte Bangels Coming-of-Age-Roman ›Oder Florida‹ lesen.“
tazChristian, soeben ist Dein erster Roman „Oder Florida“ erschienen. Erzähl mal aus Deiner Sicht: Wie kamst Du zu der Geschichte? Wie war das Schreiben für Dich?
Ich habe meine ersten zwanzig Jahre in Frankfurt (Oder) verbracht und war danach fast zehn Jahre in Hamburg. Mich bewegt es, wie weit Osten und Westen immer noch voneinander entfernt sind. Mir begegnet das immer wieder, und ich glaube, dass aus diesem Unverständnis Gewalt und Hass entstehen können. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich darüber mal einen Roman schreibe. Ich dachte an ein Sachbuch. Aber dann hat mir mein toller Agent Florian Glässing gesagt: „Wenn Du eine Zeit beschreiben willst, geht das mit einem Roman viel besser.“ Ich hab dann mit ein paar Miniaturen angefangen. Hat Spaß gemacht, aber nach jeder einzelnen dachte ich: „Das war’s, jetzt wird Dir jemand sagen, dass Du es nicht kannst.“ Aber es kam nichts.
„Oder Florida“ spielt knapp zehn Jahre nach der Wende in Frankfurt (Oder). Was hat Dich gereizt an dieser Stadt zu dieser Zeit?
Es ist alles so ungleichzeitig. Im Westen spricht alles über das Ende der Ära Kohl, aber ansonsten herrscht große Langeweile. Bald werden der 11. September und Hartz IV kommen, aber noch scheint alles friedlich. Ein großes Problem ist, dass Berti Vogts immer noch Bundestrainer ist. In den Talkshows sind immer mehr Typen, die die Welt untergehen sehen. Im Osten dagegen ist zu dieser Zeit schon seit Jahren permanenter Niedergang. Es ist die Zeit, in der die Wendeeuphorie längst verflogen ist. Die Jobs sind im Westen, viele pendeln Woche für Woche auf den Autobahnen dorthin, die Fußballclubs aus dem Osten spielen jetzt Zweite oder Dritte Liga. Dieser Niedergang hinterlässt aber auch Ruinen, merkwürdige Zonen der Ungeregeltheit, die große Momente der Freiheit ermöglichen. Und es scheint zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar, welche Seite gewinnt.
So weit, so unspektakulär. Heute wissen wir, dass im Osten damals schon Beate Zschäpe und im Westen Mohammed Atta durchs Bild liefen. Die großen Erschütterungen waren schon auf dem Weg, sie waren in dieser Zeit angelegt. Es hat nur niemand gesehen.
Und wie steht es heute um Frankfurt?
Das kann ich nicht genau sagen. Ich habe in den letzten Jahren zu tief in der Zeit um 1998 herumgegraben, um das genau von der Gegenwart trennen zu können. Ich rate aber jedem, sich die Stadt anzuschauen. Auch ein wenig länger. Schon allein, weil sie gleichzeitig Grenze und Brücke ist – beides kann sehr romantisch sein, auf seine Frankfurter Art.
Wenn man „Oder Florida“ liest, fühlt man sich sofort in die Neunziger zurückversetzt. Der Protagonist Matthias Freier ist wirklich ein Kind seiner Zeit. Welche Probleme treiben ihn um? Was macht ihn eigentlich so aktuell?
Er kämpft mit Autoritäten. Nicht weil er sie ablehnt, im Gegenteil, er bräuchte dringend gute Ratgeber. Seine Eltern können ihm ja nicht viel sagen über diese neue Zeit. Da ist nur Fliege, dieser Ex-Hausbesetzer, der jetzt den Wahnsinnsplan hat, die SPD zu übernehmen. Und dann Franziskus, der Frankfurter Mogul, der die Ossis vor allem für faul hält. Freier spürt tief in sich drin, dass es das noch nicht gewesen sein kann. Doch die meisten Vorbilder dieser Zeit scheinen so zu sein: autoritär und neoliberal.
Auch wenn es mit einem ironischen Augenzwinkern geschieht: „Oder Florida“ ist auch ein Buch über Politisierung? Was unterscheidet denn dabei die Zeit vor dem Millennium von heute?
Damals war alles noch nicht so verfestigt, das Misstrauen der Ostdeutschen, die Unterwanderung der ostdeutschen Gesellschaft durch die Nazis. Heute gibt es Pegida, dessen größter Motor nicht der Islamhass ist, sondern die Wut über die Demütigungen des letzten Vierteljahrhunderts. Diese Wut macht ironischerweise jetzt auch in den Westen rüber. Das alles hätte man damals noch einfangen können, wenn man sich interessiert hätte. Ich glaube, dass wir auch heute Prozesse nicht sehen, die wir sehen könnten. Dass sich Türen schließen, wir aber zu bequem sind, uns damit zu befassen.
Immer noch gibt es die Klischees vom „Wessi“ und vom „Ossi“. Du findest einen spielerischen Umgang mit diesen Schubladen. Denn, bei der Lektüre merkt man schnell, so richtig passen die alle nicht, oder?
Nein, natürlich nicht. Es gibt überall gute und schlimme Leute. Aber was die Menschen so erzählen, um sich aufzuplustern, wie sie Freundschaft signalisieren, da gibt es schon Unterschiede. Und wenn das Ost-West-Verhältnis nicht so düster wäre, könnte man darüber herzlich lachen.







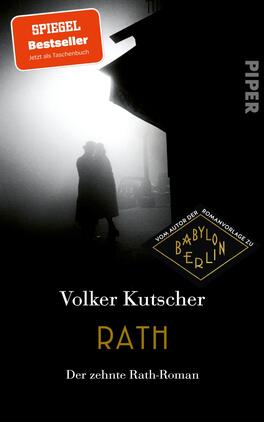
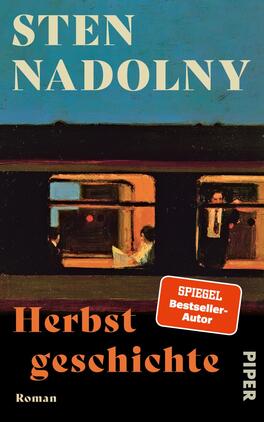

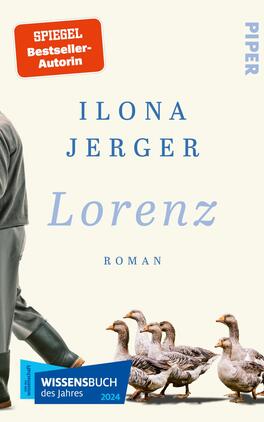
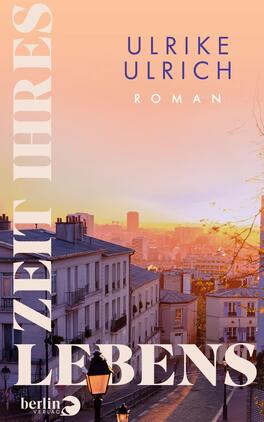



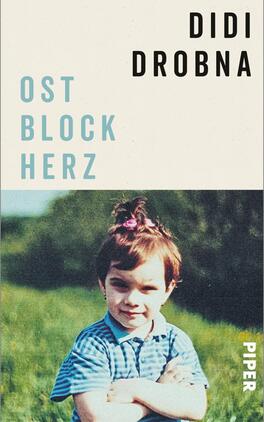



Die erste Bewertung schreiben