Produktbilder zum Buch
Im Vertrauen
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Intim, feinsinnig und umfassend analytisch bis nonchalant plaudernd. Es war mir schlicht ein Fest - selbst ohne Kenntnis aller verhandelten Werke.“
nocheinbuchBeschreibung
Briefe von frappierender Offenheit aus einem Vierteljahrhundert
Hannah Arendt und Mary McCarthy lernen sich 1945 in einer Bar in Manhattan kennen, werden Freundinnen und schreiben einander über 25 Jahre lang Briefe. Darin tauschen sich die beiden „femmes de lettres“, die nicht nur leidenschaftlich denken, sondern genauso leben, beherzt und unvoreingenommen über all das aus, was sie bewegt: Politik, Zeitgenossen, Bücher und Männer. Ihre Freundschaft in Briefen ist nicht nur ein einzigartiges zeitgeschichtliches Dokument, sondern auch das Vermächtnis der außergewöhnlichen Beziehung zweier kluger…
Briefe von frappierender Offenheit aus einem Vierteljahrhundert
Hannah Arendt und Mary McCarthy lernen sich 1945 in einer Bar in Manhattan kennen, werden Freundinnen und schreiben einander über 25 Jahre lang Briefe. Darin tauschen sich die beiden „femmes de lettres“, die nicht nur leidenschaftlich denken, sondern genauso leben, beherzt und unvoreingenommen über all das aus, was sie bewegt: Politik, Zeitgenossen, Bücher und Männer. Ihre Freundschaft in Briefen ist nicht nur ein einzigartiges zeitgeschichtliches Dokument, sondern auch das Vermächtnis der außergewöhnlichen Beziehung zweier kluger und berühmter Frauen - tiefgründig, offen, berührend und spannend wie ein guter Roman.
Über Hannah Arendt
Über Mary McCarthy
Aus „Im Vertrauen“
Einleitung
Eine Romanze in Briefen
Man kann nicht sagen, wie das Leben ist,
wie Zufall oder Schicksal die Menschen behandeln,
es sei denn, man erzählt die Geschichte.
Hannah Arendt, 12. Juni 1971
Sie sind sich 1944 in der Murray Hill Bar in Manhattan zum ersten Mal begegnet. Mary McCarthy, damals mit Edmund Wilson verheiratet, war in Begleitung des Kritikers Clement Greenberg, dessen Bruder Martin zu Hannah Arendts Kollegen im Verlag Schocken Books gehörte. Arendt, deren Besprechungen und Essays anfänglich im Menorah Journal und Contemporary Jewish Record erschienen [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Einleitung
Vorwort der Herausgeberin
Erster Teil :
März 1949 bis November 1959
Zweiter Teil :
April 1960 bis April 1963
Dritter Teil :
September 1963 bis November 1966
Vierter Teil :
Februar 1967 bis November 1970
Fünfter Teil :
November 1970 bis April 1973
Sechster Teil :
Mai 1973 bis November 1975
Epilog
Personen- und Sachregister

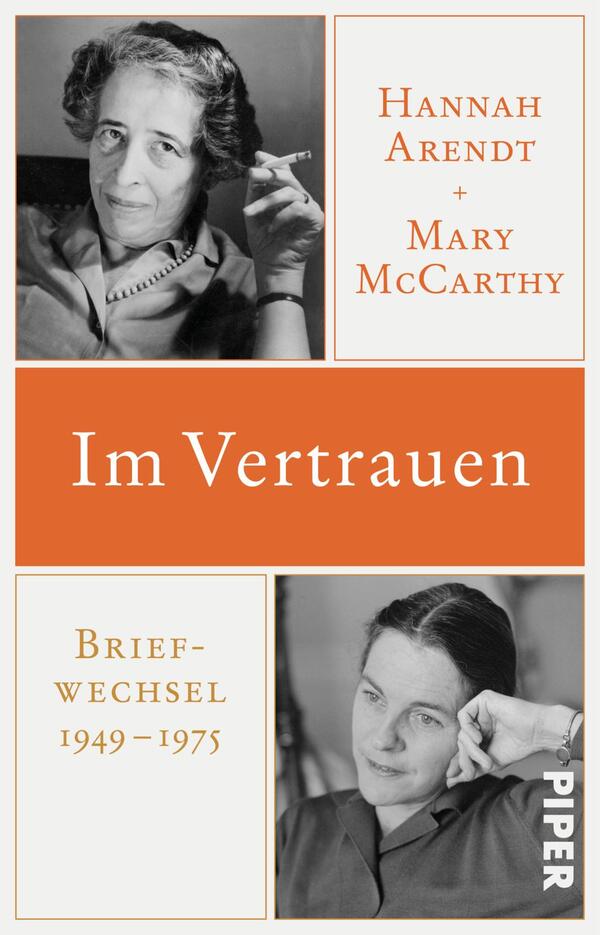





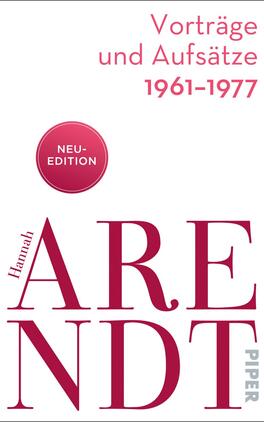


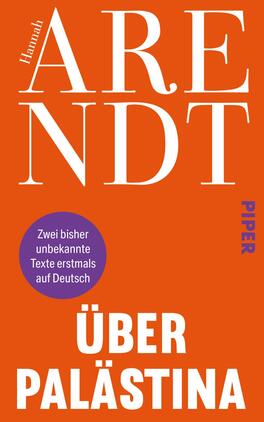

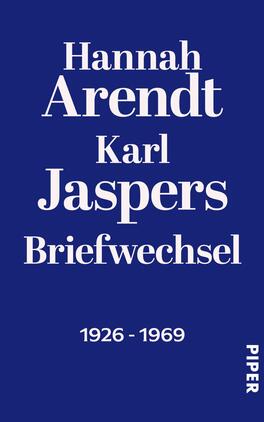
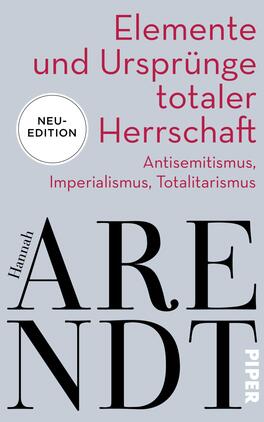
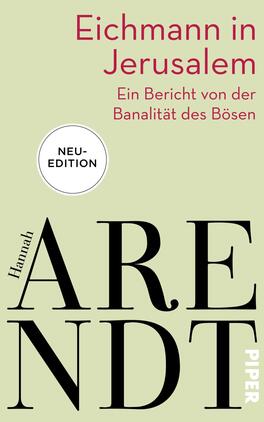







Die erste Bewertung schreiben