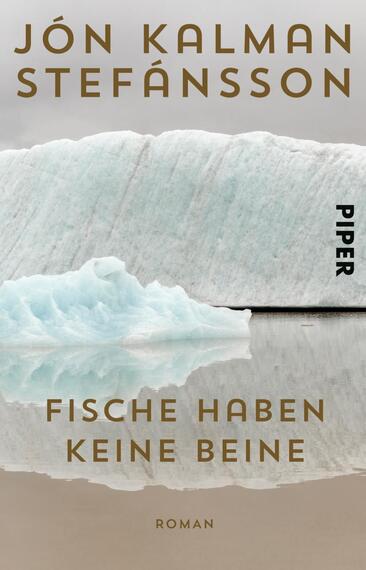
Fische haben keine Beine - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Eine Familiengeschichte über drei Generationen mit allen großen Themen, die ein Buch lesenswert machen. Klug und spannend erzählt!“
nobilis - Lebensart aus HannoverBeschreibung
Das hier ist Aris Geschichte. Und die seiner isländischen Familie. Warum aber hat Ari, Schriftsteller und Verleger, seit 25 Jahren verheiratet und mit drei Kindern gesegnet, an einem Dienstag vor drei Jahren ohne jede Vorankündigung seine Frau verlassen, um nach einem Zwischenspiel in einem gottverlassenen isländischen Hotel nach Kopenhagen zu verschwinden? Schwer zu sagen. Aber Ari kommt zurück, nachdem ihn sein sterbender Vater darum bittet. Ein altes Foto von ihm und seiner Mutter lassen Aris Erinnerungen aufleben, an seine Familie und seine eigene Jugend im schwärzesten Loch von allen:…
Das hier ist Aris Geschichte. Und die seiner isländischen Familie. Warum aber hat Ari, Schriftsteller und Verleger, seit 25 Jahren verheiratet und mit drei Kindern gesegnet, an einem Dienstag vor drei Jahren ohne jede Vorankündigung seine Frau verlassen, um nach einem Zwischenspiel in einem gottverlassenen isländischen Hotel nach Kopenhagen zu verschwinden? Schwer zu sagen. Aber Ari kommt zurück, nachdem ihn sein sterbender Vater darum bittet. Ein altes Foto von ihm und seiner Mutter lassen Aris Erinnerungen aufleben, an seine Familie und seine eigene Jugend im schwärzesten Loch von allen: Keflavik. Dort lernte Ari die amerikanischen Soldaten kennen, die Beatles, Pink Floyd - und die Mädchen. Eines von ihnen hat Ari bis heute nicht vergessen, und ihr Schicksal hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet. - Eine große, eigenwillige Familiengeschichte von Glück, Freude, Rechtschaffenheit und Verlangen.
Über Jón Kalman Stefánsson
Aus „Fische haben keine Beine“
Prolog
Es hat selbst der Sonnenschein nichts dagegen ausrichten können und erst recht keine schönen Worte wie Regenbogen oder Liebe, die vollkommen nutzlos waren, man konnte sie auch unbesorgt wegwerfen – es hat alles mit dem Tod angefangen.
Wir haben so vieles: Gott, Gebete, Musik, Wissenschaft und Technik, jeden Tag neue Erfindungen, immer perfektere Mobiltelefone, stärkere Radioteleskope, doch dann stirbt jemand, und du hast gar nichts mehr, du tastest nach Gott, greifst nach der Enttäuschung, nach seinem Kaffeebecher, der Bürste mit ihren Haaren darin, du [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Poetisch, melancholisch und realistisch zugleich, mit einem tiefgründigen Blick auf das Leben und die Menschen hat Jón Kalman Stefánsson ein Buch geschrieben, das man nicht so schnell vergessen wird.“
mare„Wie in allen Romanen geht es Jón Kalman um die großen Fragen, um Liebe, Verantwortung und Schuld und ihre Verknüpfung mit dem Alltäglichen, der Familie, der Arbeit, dem Zustand des Gemeinwesens.“
icelandoverview.com„In Stefánssons Sprache steckt die Kargheit einer Küste, an der der Fischfang auch dann noch das Leben bestimmt, als es schon gar keinen Fisch mehr gibt. Und das ehrliche Pathos aller Gefühle, die in einem Menschenleben Platz finden. Ein großartiges Buch.“
buchreport express„Ein poetischer, teils auch schwermütiger Roman über Familie und Heimat, Flucht und Rückkehr. Geschrieben von Jón Kalman Stefánsson, einem großen isländischen Erzähler, der die Gefühlslage seiner Landsleute bestens kennt.“
Ruhr Nachrichten„Stefánsson weiß, wie große Romane geschrieben werden. Und dieser klingt lange nach.“
Hamburger Morgenpost„Der isländische Schriftsteller verhandelt erneut die ganz großen Fragen... Es geht um Schuld, Reue und Weiterleben. Um Familie und Freundschaften. Um lebensfeindliche dörfliche Strukturen. Um zu viel Schüchternheit, Schweigen und die mögliche Rettung durch Literatur.“
Die Rheinpfalz„Eine Familiengeschichte über drei Generationen mit allen großen Themen, die ein Buch lesenswert machen. Klug und spannend erzählt!“
nobilis - Lebensart aus Hannover



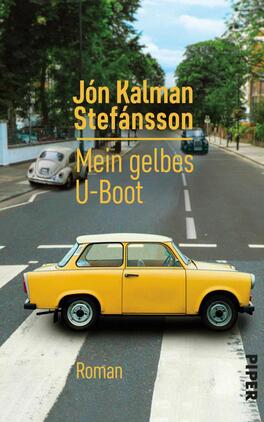

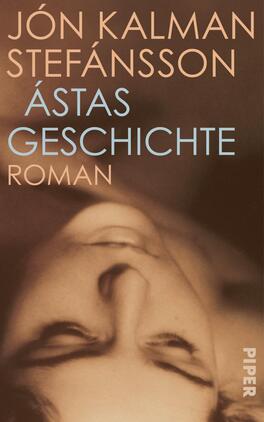
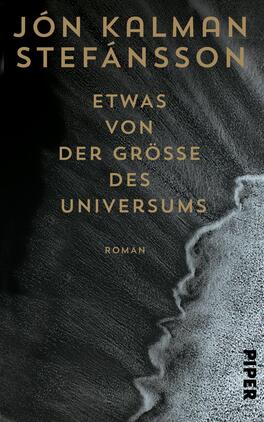
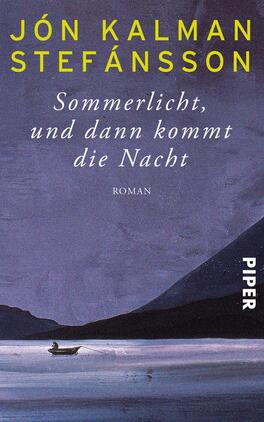


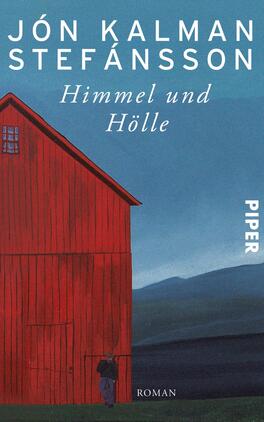

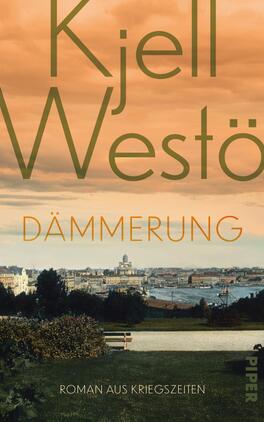

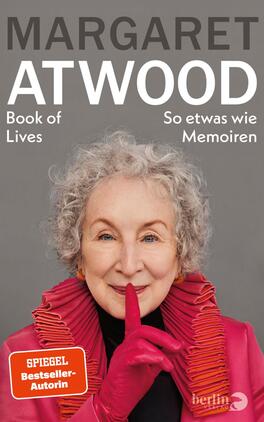



Die erste Bewertung schreiben