Das Wunder von Bern
Welche Bedeutung hat der WM Sieg 1954 auf den Fußball in Deutschland heute? Prof. Dr. Hermann Schäfer erklärt die gesellschaftliche Bedeutung von dem „Wunder von Bern“
weitere Infos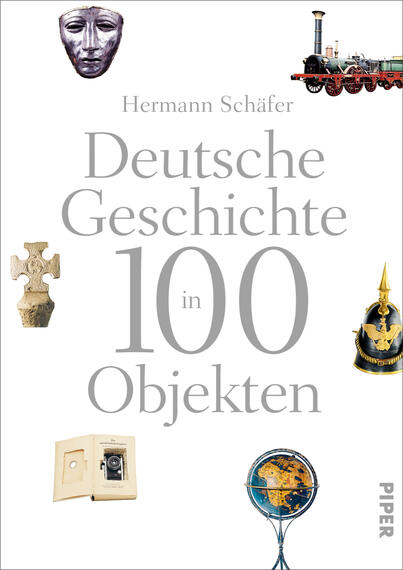
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Jede Objektgeschichte fesselt auf andere Weise, in der Zusammenschau zeigen sie ein großes, facettenreiches Gesamtbild unserer Geschichte – ein rundum gelungenes Buch!“
Prof. Dr. Lothar GallWas haben diese Objekte sowie eine Ritterrüstung, die Tabakdose Friedrichs des Großen und der WM-Fußball von 1954 gemeinsam? Es sind drei von 100 Mosaiksteinen der deutschen Geschichte, stumme Zeugen der Vergangenheit. Hermann Schäfer, einer der führenden Vertreter der deutschen Museumsszene, fügt sie in diesem opulent ausgestatteten Band zusammen. Anschaulich und gut verständlich bringt er die Objekte zum Sprechen und macht zugleich auch ihre erstaunliche Umdeutung im Dienst politischer Interessen und gesellschaftlicher Umbrüche deutlich. Für den interessierten Laien leicht zugänglich, eine…
Was haben diese Objekte sowie eine Ritterrüstung, die Tabakdose Friedrichs des Großen und der WM-Fußball von 1954 gemeinsam? Es sind drei von 100 Mosaiksteinen der deutschen Geschichte, stumme Zeugen der Vergangenheit. Hermann Schäfer, einer der führenden Vertreter der deutschen Museumsszene, fügt sie in diesem opulent ausgestatteten Band zusammen. Anschaulich und gut verständlich bringt er die Objekte zum Sprechen und macht zugleich auch ihre erstaunliche Umdeutung im Dienst politischer Interessen und gesellschaftlicher Umbrüche deutlich. Für den interessierten Laien leicht zugänglich, eine Schatzkiste für immer neue Entdeckungen: Aus 100 fesselnden Geschichten wird eine große historische Erzählung. Ein farbiges Panorama der vergangenen über zwei Jahrtausende, von den vorgeschichtlichen Anfängen bis in die jüngste Gegenwart.
Vorwort
Deutsche Geschichte anhand von 100 Objekten zu erzählen ist – schon allein aufgrund des immensen Umfangs eines solchen Projekts – eine gewaltige Herausforderung: Jahrtausende sind in den Blick zu nehmen, in jeder Epoche Erinnerungswürdiges, möglichst Geschichtsträchtiges, vielleicht Überraschendes aufzufinden und am Ende die vielen Einzelteile zu einem großen Ganzen zusammenzufügen – wie farbige Mosaiksteinchen, die jedes für sich, aber erst recht als Gesamtbild ihre magische Wirkung auf den Betrachter entfalten.
Tatsächlich besitzt die Zahl 100 für viele [...]
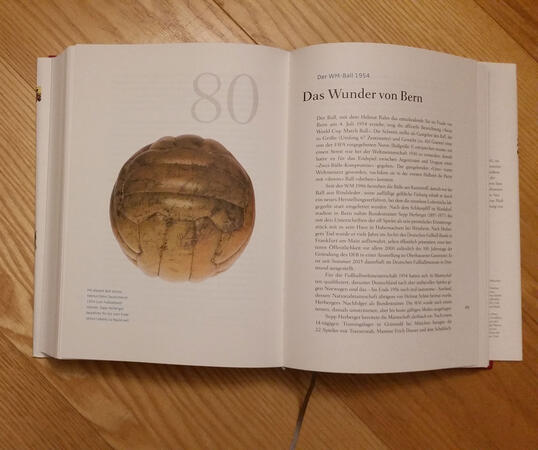
Welche Bedeutung hat der WM Sieg 1954 auf den Fußball in Deutschland heute? Prof. Dr. Hermann Schäfer erklärt die gesellschaftliche Bedeutung von dem „Wunder von Bern“
weitere Infos„Objekte erzählen Geschichte – aber nur, wenn sie jemand so prägnant zum Sprechen bringt wie Hermann Schäfer.“
Wolfgang Herles„Hermann Schäfer hat 100 Objekte aus 2000 Jahren deutscher Geschichte ausgewählt. Darunter eine Pestarztmaske, die Tabaksdose Friedrich des Großen, der Blitzableiter und die Aspirintablette. Die Geschichten, die sich an jedem einzelnen Objekt ablesen lassen, sind erstaunlich komplex und facettenreich.“
WDR 3 Mosaik„Wie Deutsche ihre Geschichten und Objekte im Laufe der Jahrhunderte immer wieder neu gedeutet, gebraucht, missbraucht haben, zeigt Hermann Schäfer wunderbar an mehreren Beispielen.“
Sächsische Zeitung„Hermann Schäfer erzählt anhand von 100 Gegenständen vielfältig und lebendig die deutsche Geschichte nach, weiß über die Tabakdose Friedrichs des Großen oder Jakob Hemmers Blitzableiter ebenso spannend zu berichten wie über Merkels Handy.“
Stuttgarter NachrichtenDer persönliche Tipp von Prof. Dr. Rainer Blasius: „Der frühere Präsident der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn präsentiert eine höchst informative und vor allem leicht verständliche Objekte-Schau. Ganzseitige, farbige Abbildungen mit Kurzerläuterungen dienen als Aufmacher für die einzelnen Artikel, die vom technikgeschichtlichen Wissen des Autors und von seiner museumspädagogischen Erfahrung sehr profitieren.“
Sachbuch Bestenliste„Der Gründungsdirektor des Hauses der Geschichte in Bonn hat mit einem der schönsten Bücher des Jahres ein neues Meisterstück geliefert: 100 Objekte sind der Anlass für einhundert meisterhafte Essays, die ein Bild deutscher Geschichte zeichnen, das nicht indoktriniert, sondern einlädt, nachzudenken, sich überraschen und verunsichern zu lassen und das Verständnis von Epochen, Ereignissen und fremden Welten verständlich machen will.“
Prof. Dr. Peter Steinbach„Zu jedem der 100 Objekte findet man Überraschendes, manchmal ganz Unglaubliches. Der Kunstgriff, den Zeitgeist einer Epoche, die Entstehungsgeschichte des Objekts, seinen Stellenwert im Kontext vergleichbarer Objekte, die vielfach abenteuerliche Geschichte auf dem Weg in eine Sammlung zu beschreiben, ist für jeden, der Sinn für Geschichte hat, von hohem Reiz.“
Prof. Dr. Hans-Peter Schwarz„Von der römischen Gesichtsmaske im Teutoburger Wald bis zum Handy von Bundeskanzlerin Merkel schmökert man mit Lust und Gewinn in der deutschen Geschichte.“
NZZ Geschichte„Schäfer möchte den Leser neugierig machen auf die Auseinandersetzung mit der Geschichte. Und dieses Ziel erreicht er auf sehr kurzweilige Weise.“
Mannheimer Morgen„Mit seinen im Buch vorgestellten Gegenständen möchte Schäfer Zusammenhänge zu einem Gesamtbild weben, er wirbt für eine ›Sensibilisierung für die Objekte‹, will eine Auseinandersetzung mit den von ihm vorgeschlagenen Themen provozieren. Es gelingt famos.“
Kölner Stadt-Anzeiger„Hermann Schäfers ›Deutsche Geschichte in 100 Objekten‹ bietet wunderbare Zugänge zu den Epochen deutscher Geschichte. Objekte, die die Schnittstellen deutscher Geschichte markieren, erleichtern die Identifizierung mit der Vergangenheit und machen neugierig auf Museumsbesuche.“
Hans-Martin Hinz, Präsident des International Council of Museums, ICOM„Eine lebendige und anschauliche Schilderung zentraler Wegmarken, Wendepunkte, Wandlungen und Weiterentwicklungen deutscher Vergangenheit. (...) Dringende Empfehlung.“
Gießener Allgemeine„Der Leser erfährt eine Menge über die deutsche Vergangenheit und die kollektiven Erinnerungen einer Nation – und doch dürfen Vergangenheit und Erinnerung die Rätsel bleiben, die sie sind.“
Der Spiegel„Jede Objektgeschichte fesselt auf andere Weise, in der Zusammenschau zeigen sie ein großes, facettenreiches Gesamtbild unserer Geschichte – ein rundum gelungenes Buch!“
Prof. Dr. Lothar GallVorwort
Aus Vorgeschichte und Antike
1 Homo erectus und die „deutsche“ Vorgeschichte
Die Speere von Schöningen
2 Weltsicht in der Bronzezeit
Die Himmelsscheibe von Nebra
3 Die Schlacht im Teutoburger Wald: Arminius contra Varus
Eine römische Gesichtsmaske
4 Die deutsche Weinkultur
Das Neumagener Weinschiff
Aus dem Mittelalter
5 Die Wikinger
Haithabu 1
6 Glocken im kulturellen Wandel
Der Saufang
7 Königsthron – Geschichte und Mythos
Der Karlsthron in Aachen
8 Gottes-, Herrschafts- und Wirtschaftszeichen
Das Trierer Marktkreuz
9 Gottesgnadentum und Kaiserherrschaft
Die Reichskrone
10 Frömmigkeit und Renovatio imperii
Christussäule und Bernwardtür
11 Heldenepik und das Ideal der Treue
Das Nibelungenlied
12 Der Ritter als Idol
Der Bamberger Reiter
13 Gesetzgebung und Rechtsprägung
Der Sachsenspiegel
Vom Spätmittelalter in die Frühe Neuzeit
14 Armen- und Krankenpflege im Spätmittelalter
Kabäuschen im Lübecker Heiligen-Geist-Hospital
15 Klöster als Wirtschaftsunternehmen
Das Tennenbacher Güterbuch
16 Mit den Städten blühen die Zünfte auf
Die Schmiedefenster im Freiburger Münster
17 Königswahl und Kaisermacher
Die Goldene Bulle
18 Die Hanse – eine Wirtschaftsmacht
Die Bremer Kogge
19 Ritter – Söldner – Landsknechte – stehende Heere
Der Plattenrock
20 Universitäten – Gründung und Wandel
Das Große Siegel der Universität Heidelberg
21 Kathedralen und Dombauhütten in der Spätgotik
Das Parlerzeichen auf der Parlerin
22 Revolution der Wissenstechnik
Gutenbergs bewegliche Lettern
23 Globalisierung im 15./16. Jahrhundert
Martin Behaims Erdapfel
24 Körperbilder und Geschlechterrollen in der Renaissance
„Das Frauenbad“ von Albrecht Dürer
25 Stifter, Kunst und Politik
Die „Markgrafentafel“ von Hans Baldung Grien
26 Bier – vom Wasserersatz zum Volks- und Kultgetränk
Das Reinheitsgebot
27 Handel im Frühkapitalismus
In der „Goldenen Schreibstube“
28 Bauernkrieg und frühbürgerliche Revolution
Werner Tübkes Panoramabild in Bad Frankenhausen
29 Bibelübersetzung und Reformation
Martin Luthers Biblia Deutsch
30 Stadtleben in Spätmittelalter und Früher Neuzeit
Die Augsburger Monatsbilder
Aus der Frühen Neuzeit
31 Der Dreißigjährige Krieg
Die Zapfhähne aus der Schlacht bei Wittstock
32 Jüdisches Leben und Traditionen
Ein Chanukka-Leuchter
33 Der Schwarze Tod
Die Pestarztmaske
34 Von der Ewigkeit zur Endlichkeit des Lebens
Der „Tanzende Tod“
35 Einwanderungsland Preußen
Das Edikt von Potsdam
36 Architektur und Baukunst im Barock
Balthasar Neumanns Instrumentum Architecturae
37 Das „Mirakel des Hauses Brandenburg“
Die Tabakdose Friedrich des Großen
38 Erhellende Aufklärung
Der Blitzableiter
39 Französische Revolution in Deutschland
Goethes „Freiheitsbaum“
Aus dem 19. Jahrhundert
40 An der Schwelle zur Moderne: Die preußische Reformpolitik
Das Oktoberedikt
41 Altes Volksgut und neue Ideen: Die Romantik
Die Sammlung der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm
42 Die Völkerschlacht – vom Befreiungskrieg zum Nationalismus
Skelett mit Kanonenkugel
43 Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
Beethovens „Neunte“
44 Ingenieurskunst auf der Großbaustelle
Der Grabstein von Johann Gottfried Tulla
45 Erste Demokratieversuche und ihre Niederschlagung
Die Hambacher Fahne
46 Der Deutsche Zollverein
„Gränzverlegenheiten“
47 Die Eisenbahn – Deutschlands Aufbruch in die Industrialisierung
Der Adler
48 „Einigkeit und Recht und Freiheit“
Der Erstdruck des „Deutschlandlieds“
49 Landwirtschaft im Wandel
Der Goldene Pflug
50 Der deutsche Militarismus
Die Pickelhaube
51 Armutsflüchtlinge und Auswanderung
Geburtsmatrikel von Löb Strauß
52 Das Gespenst einer alternativen Gesellschaftsutopie
Das Kommunistische Manifest
53 Die Paulskirche: Wiege der deutschen Demokratie
Der „Zug der Volksvertreter“ von Johannes Grützke
54 Die Elektroindustrie
Die Dynamomaschine von Werner von Siemens
Aus dem Kaiserreich
55 Die Proklamierung des Kaiserreichs
„Versailles“ von Anton von Werner
56 Die Anfänge der Arbeiterbewegung
Die Traditionsfahne der Sozialdemokratie
57 Malerischer Realismus in der Industrialisierung
Das „Eisenwalzwerk“ von Adolph Menzel
58 Grundlegung des Sozialstaats – das Zuckerbrot zur Peitsche
Die Kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881
59 Der Start ins automobile Zeitalter
Der Benz Patent-Motorwagen Nummer 1
60 Die pharmazeutisch-chemische Industrie wird Weltmarktführer
Das Aspirin
61 Von der Bildergeschichte zum modernen Comic
Die Bleistifte des „lachenden Pessimisten“ Wilhelm Busch
62 Weltmachtpolitik und Kolonialismus
Der Sarotti-Mohr
Aus dem 20. Jahrhundert
63 Industrialisierter Krieg und Kriegsschuldfrage
Das MG 08/15
64 Die Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs
„Der Krieg“ – das Triptychon von Otto Dix
65 Frankreichs Triumph und Deutschlands Rache
Der Waffenstillstandswaggon von Compiègne
66 Ausrufung der Republik
Die Scheidemann-Schallplatte
67 Gleichberechtigung und Emanzipation
„Frauen! – für die Wahl“
68 Der Nationalsozialismus als Weltanschauung und Ideologie
Hitlers Mein Kampf
69 Terror gegen den Geist: Die Bücherverbrennung
Ein Buch, das den Flammen entging
70 Antisemitismus, Rassenwahn und Massenmord
Der „Judenstern“
71 Rundfunk im Dienst der Propaganda
Der Volksempfänger
72 Widerstand gegen den Nationalsozialismus
Die Werkbank von Georg Elser
73 Staatlicher Willkür und Anmaßung
Nicht einfach „eine“ Guillotine
Aus der Zeitgeschichte seit 1945
74 Der 8. Mai 1945 – Niederlage und Befreiung
Die sowjetische Fahne auf dem Reichstag
75 Flucht und Vertreibung
Die Suchdienst-Kartei
76 Die Nürnberger Prozesse – das erste internationale Strafgericht
Die Anklagebank
77 Hilfe in großer Not: Mythos und Realität
Carepaket und Westpäckchen
78 Die Erfindung des Computers – aus Rechenfaulheit
Zuse-Rechenmaschine Z3
79 Staatsgründung mit eingeschränkter Souveränität
Das Besatzungsstatut
80 Das Wunder von Bern
Der WM-Ball 1954
81 Ein geeinter Kontinent – Idee und Realität
Die Europaflagge
82 Von zwei Armeen im Kalten Krieg zu einer im Einsatz
Helme von Bundeswehr und NVA
83 Antibabypille versus Wunschkindpille
Anovlar und Ovosiston
84 Vom KdF-Automobil zum Wirtschaftswunder-Käfer
Der Volkswagen
85 Einwanderung ins Wirtschaftswunder
Das „Gastarbeiter“-Moped
86 Die RAF und der Deutsche Herbst
Magnum-Revolver
87 Holocaust – eine TV-Serie: Die Vergangenheit holt die Deutschen ein
Bilder einer Familiengeschichte
88 Der Volksaufstand am 17. Juni 1953
Die Geheimkamera
89 Überwachung und „Vorratsdatenspeicherung“ in der Diktatur
Die Geruchsproben der Stasi
90 Grenze im geteilten Deutschland
Abfertigungskabine im Tränenpalast
91 Der erste Deutsche im All – ein Bürger der DDR
Der Raumanzug von Sigmund Jähn
92 Die Friedensbewegung in der DDR
„Schwerter zu Pflugscharen“
93 Die Öffnung der Mauer
Schabowskis Zettel
Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert
94 Die Immer-und-überall-Kultur
MPlayer3 (Pontis)
95 Protestbewegungen in der Bundesrepublik
Sprechende Logos
96 Geld – Währung – Inflation
Die DM-Urpatrize
97 „Wir sind Papst“
Der Stuhl Benedikts XVI.
98 Ausspähen unter Freunden
Merkels Handy
99 Die Energiewende
Großspeicherbatterien
100 Jeder ist ein Fremder – fast überall
Das Plakat „Dein Christus – ein Jude“
Dank
Anhang
Literatur
Bildnachweis
Personenregister
Die erste Bewertung schreiben