
Das Haus der Granatäpfel - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Perfekt verbindet Lydia Conradi historische Ereignisse mit einer fiktiven, dramatischen Geschichte, die mich sehr berührt hat.“
vonmainbergsbuechertipps.wordpress.comBeschreibung
Smyrna, 1912: Das Paradies – so nennen viele die Metropole am Ägäischen Meer, die inmitten von Krisen wirkt wie ein weltvergessenes Idyll. In die Stadt, in der Menschen aus aller Herren Länder seit jeher in Eintracht leben, kommt die Berlinerin Klara, um mit Peter, dem Sohn eines Kaufhausmagnaten, eine Zweckehe einzugehen. Doch er kann die lebenshungrige junge Frau nicht glücklich machen, und Klara verliert ihr Herz an den Arzt Sevan. Aber auch er ist gebunden, und als der Erste Weltkrieg ausbricht, beschließen beide, trotz ihrer Liebe füreinander ihre Partner nicht im Stich zu lassen. Für…
Smyrna, 1912: Das Paradies – so nennen viele die Metropole am Ägäischen Meer, die inmitten von Krisen wirkt wie ein weltvergessenes Idyll. In die Stadt, in der Menschen aus aller Herren Länder seit jeher in Eintracht leben, kommt die Berlinerin Klara, um mit Peter, dem Sohn eines Kaufhausmagnaten, eine Zweckehe einzugehen. Doch er kann die lebenshungrige junge Frau nicht glücklich machen, und Klara verliert ihr Herz an den Arzt Sevan. Aber auch er ist gebunden, und als der Erste Weltkrieg ausbricht, beschließen beide, trotz ihrer Liebe füreinander ihre Partner nicht im Stich zu lassen. Für eine Weile erweist sich das Paradies wahrhaftig noch als Oase im Grauen, doch dann entbrennt ein schicksalhafter Kampf um die Stadt. Und plötzlich muss Klara eine Entscheidung fällen, die über Menschenkraft hinausgeht, um etwas von Smyrnas Geist und ihrer Liebe zu Sevan zu bewahren ...
Über Lydia Conradi
Aus „Das Haus der Granatäpfel“
Landstraße nach Smyrna, Mai 1894
Der Tag, an dem Sevan die Welt entdeckte, war sein neunter Geburtstag, der Himmel war blau bis auf eine scharf umrissene Wolke, und die Welt hieß Smyrna.
Sie waren bei Sonnenaufgang aufgebrochen. Onkel Bedros saß vorn auf dem Karren und lenkte das Maultier, und Sevan hockte hinten und gab acht, dass keine der Holzkisten herunterfiel. Auf seine Aufgabe war Sevan stolz. Onkel Bedros hätte genauso gut einen seiner Brüder oder Cousins mitnehmen können, mutige, geschickte Burschen, die für die Familie ihren Mann standen, aber er hatte sich [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Lydia Conradi hat mit dieser Geschichte etwas sehr Bewegendes, Komplexes und absolut Atmosphärisches geschaffen. (…) Eine klare Leseempfehlung.“
magischemomentefuermich.blogspot.de„Über 600 Seiten prall gefüllt mit Denkanstößen, geschichtlichem Hintergrundwissen und persönlichen Schicksalsschlägen von Dramatik und Hoffnung.“
fantasie-und-traeumerei.blogspot.de„Ein sinnliches Vergnügen.“
Freundin„Perfekt verbindet Lydia Conradi historische Ereignisse mit einer fiktiven, dramatischen Geschichte, die mich sehr berührt hat.“
vonmainbergsbuechertipps.wordpress.com





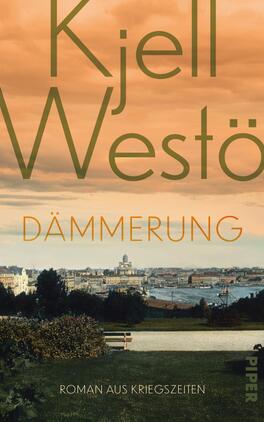
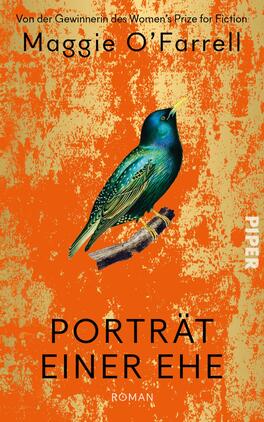


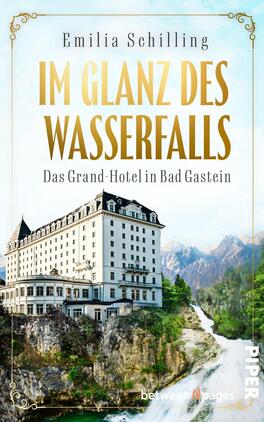

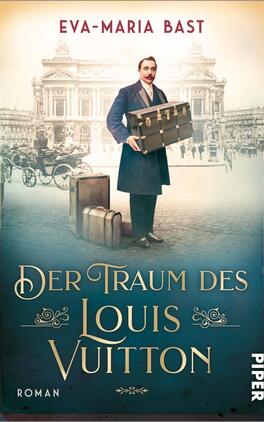
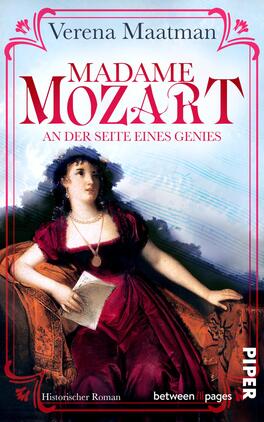





Die erste Bewertung schreiben