
Tausend Nächte und ein Tag - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Abenteuer, Historie und orientalisches Flair – in „Tausend Nächte und ein Tag“ entführt Lydia Conradi ihre Leser in die aufregende Welt der frühen Archälogie, zum Turmbau und den Hängenden Gärten von Babylon. In diesem fesselnden historischen Roman erzählt Conradi farbenprächtig und atmosphärisch von einer Liebe, die nicht sein darf, und einer Frau zwischen Leidenschaft und Vernunft.
1899, ganz Berlin ist im Orient-Fieber, denn der Archäologe Robert Koldewey hat soeben das mythische Babylon aus dem Wüstensand gegraben. Auch die junge Senta ist den jahrtausendealten Kulturen verfallen, doch…
Abenteuer, Historie und orientalisches Flair – in „Tausend Nächte und ein Tag“ entführt Lydia Conradi ihre Leser in die aufregende Welt der frühen Archälogie, zum Turmbau und den Hängenden Gärten von Babylon. In diesem fesselnden historischen Roman erzählt Conradi farbenprächtig und atmosphärisch von einer Liebe, die nicht sein darf, und einer Frau zwischen Leidenschaft und Vernunft.
1899, ganz Berlin ist im Orient-Fieber, denn der Archäologe Robert Koldewey hat soeben das mythische Babylon aus dem Wüstensand gegraben. Auch die junge Senta ist den jahrtausendealten Kulturen verfallen, doch als Frau ist ihr der Zugang versperrt. Sie beschließt, eine eigene Expedition auszustatten, begleitet von dem Assyriologen Winfried, der sie liebt, und dem undurchschaubaren Briten Christopher. Auf der strapaziösen Reise in das umkämpfte Land zwischen den Strömen brodeln gefährliche Leidenschaften. Die Lage spitzt sich zu, als die Gruppe von Beduinen als Geiseln genommen wird. Einzig Faysal, der Sohn des Sheik, sieht in den Europäern mehr als ein Faustpfand. Er und Senta gehören verschiedenen Welten an, doch in den schwarzblauen Nächten der Wüste brechen sich Gefühle Bahn, die so berauschend sind wie der Zauber des Orients und so alt wie seine im Sand verborgenen Kulturen ...
Der Zauber des Orients eingefangen zwischen zwei Buchdeckeln – ein farbenprächtiger Historienroman um eine ebenso faszinierende wie lebensgefährliche Reise zu den Strömen Mesopotamiens und den Geheimnissen der Vergangenheit.
Über Lydia Conradi
Aus „Tausend Nächte und ein Tag“
1
Ashmolean Museum, Archäologische Abteilung, Büro des Kurators
Oktober, Beginn des akademischen Jahres
„Schenken Sie mir eine Sekunde Ihrer kostbaren Zeit, mein Freund? Ich würde diesen jungen Mann hier gern Ihrer Obhut anvertrauen.“
Percy hatte zwei Paar Schritte auf den knarrenden Dielen erkannt, als auch schon die Tür aufschwang. Es bestürzte ihn, wie sehr er sich erschrocken hatte. Minette, seine Sekretärin, ließ für gewöhnlich niemanden zu ihm durch. Bei der Direktion hatte er seinerzeit eigens darum gebeten: »Wie gut die Dame in Stenografie ist, interessiert [...]






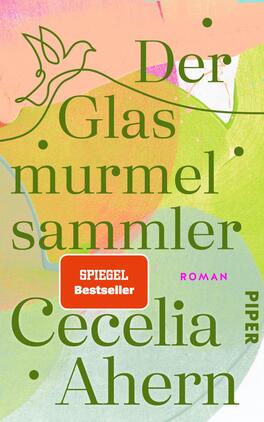












Die erste Bewertung schreiben