Produktbilder zum Buch
Café Buchwald (Cafés, die Geschichte schreiben 1)
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Die Autorin hat mich in eine Welt entführt, die mich total fasziniert hat und in der ich mich sehr wohlgefühlt habe.“
ilonas_buecherweltBeschreibung
Willkommen in Berlins legendärer Konditorei!
Berlin, 1896: Emma liebt den herrlichen Duft von Baumkuchen, der die Backstube der Familie erfüllt. Während ihr Vater die herrlichsten Leckereien zaubert, kümmert sich die Mutter um den Verkauf. Niemand bezweifelt, dass Emma und der Lehrjunge Fritz bald heiraten und gemeinsam das Geschäft weiterführen.
Doch dann wird Emmas Vater schwer krank und nimmt ein dunkles Geheimnis mit ins Grab, das den Fortbestand des Cafés in Gefahr bringen könnte. Als Emma sich auch noch in den Architekturstudenten Max verliebt, der ihr ganz neue Welten eröffnet, muss sie…
Willkommen in Berlins legendärer Konditorei!
Berlin, 1896: Emma liebt den herrlichen Duft von Baumkuchen, der die Backstube der Familie erfüllt. Während ihr Vater die herrlichsten Leckereien zaubert, kümmert sich die Mutter um den Verkauf. Niemand bezweifelt, dass Emma und der Lehrjunge Fritz bald heiraten und gemeinsam das Geschäft weiterführen.
Doch dann wird Emmas Vater schwer krank und nimmt ein dunkles Geheimnis mit ins Grab, das den Fortbestand des Cafés in Gefahr bringen könnte. Als Emma sich auch noch in den Architekturstudenten Max verliebt, der ihr ganz neue Welten eröffnet, muss sie eine schwere Entscheidung treffen …
Das großartige Panorama Berlins um 1900 und der Duft eines köstlichen Klassikers
Das Café Buchwald ist eine der ältesten Konditoreien Berlins. Berühmt ist es für seinen Baumkuchen: ein ringförmiges Gebäck, das mit Schokolade oder Zuckerglasur überzogen ist und meist zu Weihnachten gegessen wird.
Das amerikanische Online-Magazin Buzzfeed nahm das Café Buchwald in die Liste mit den „25 Bäckereien auf der Welt, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt“ auf. Neben Touristen gehen dort auch Schauspieler und Politiker ein und aus. Eine echte Institution eben.
Weitere Titel der Serie „Cafés, die Geschichte schreiben“
Über Maria Wachter
Aus „Café Buchwald (Cafés, die Geschichte schreiben 1)“
Vorwort
Herbst 1882
„Glaubst du, wir werden eine Prinzessin sehen?“, fragte Emma hoffnungsvoll.
„Eher nicht“, lachte Vater. „Wir liefern nur unseren Baumkuchen. Aber Lakaien in schönen Uniformen werden wir begegnen, auch Soldaten, Dienern und hohen Herrschaften in eleganten Kleidern … Vielleicht erhaschen wir sogar einen Blick auf unseren Auftraggeber, Prinz Friedrich Leopold von Preußen.“
Enttäuscht lehnte sich Emma in die Bank im Wartebereich des Cottbusser Bahnhofs zurück. Lakaien … hohe Herrschaften … vielleicht Prinz Friedrich Leopold … Viel lieber wäre sie einer [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„›Café Buchwald‹ ist eine lebendige Geschichte, die einen von der ersten Seite an gefangen nimmt. Der Schreibstil ist einnehmend und bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen macht das Lesen noch mehr Spaß!“
Radio Euroherz„Die damalige Zeit wird anschaulich und nachvollziehbar dargestellt, die Charaktere ausdrucksstark beschrieben. Ein herrlicher Schmöker für kalte Herbsttage.“
Mainhattan Kurier„Die Autorin hat mich in eine Welt entführt, die mich total fasziniert hat und in der ich mich sehr wohlgefühlt habe.“
ilonas_buecherweltWer liebt sie nicht? Die legendären, berüchtigten oder versteckten Cafés in den schönsten Städten der Welt? Es sind Orte der Begegnung, wo man sitzt, genießt, diskutiert, sich kennen und lieben lernt. Es sind Orte, die Geschichte in sich tragen – und die Geschichten ihrer Besucher, ihrer Besitzer, ihrer Zeit erzählen.
„Cafés, die Geschichte schreiben“ ist eine neue Reihe mit historischen Romanen: Im Zentrum steht jeweils ein ganz besonderes Café, in dem fiktive Romanfiguren und realhistorische Persönlichkeiten vor beeindruckendem Panorama und mit viel Zeitkolorit die Geschicke eines Ortes erlebbar machen.
Auftakt der Reihe ist im September 2022 Maria Wachters Roman »Café Buchwald» über eine einmalige Berliner Institution um 1900 und den unaufhaltsamen Aufstieg des köstlichen Baumkuchens.
Lassen Sie sich an die schönsten Orte der Welt entführen, wo zwischen Tassengeklapper und Stimmengewirr, Kronleuchtern, Bistrotischchen und Theken Geschichten erzählt werden, die das Leben schrieb – oder zumindest so hätte schreiben können …
1852 wurde in Cottbus die „Baumkuchenfabrikation-Konditorei und Café“ gegründet. Sie zog zur Jahrhundertwende nach Berlin und ist heute die älteste Konditorei der Stadt. Das Café Buchwald befindet sich in einem Haus an der Moabiter Brücke, das um 1900 im Zuge der Entwicklung des Hansaviertels erbaut wurde.
Noch immer backen die Nachfahren des Gründers ihren berühmten Baumkuchen: ein ringförmiges Gebäck, das mit Schokolade oder Zuckerglasur überzogen ist und meist zu Weihnachten gegessen wird. Das amerikanische Online-Magazin Buzzfeed nahm das Café Buchwald in die Liste der „25 Bäckereien auf der Welt, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt“ auf. Neben Touristen gehen dort auch Schauspieler und Politiker ein und aus. Eine echte Institution eben.
„Tempo, Tempo!, hieß es im pulsierenden Berlin um 1900. Überall wurde gebaut: Straßen, Plätze, Alleen, Regierungsgebäude, Hotels, und natürlich auch viele Cafés. Für Mietskasernen wurden Elendshütten geschliffen, für die Villen der Reichen Bäume gerodet. Dieses Berlin, von dem heute nicht mehr viel steht, wollte ich wieder auferstehen lassen.
Wie kamen die Menschen damals mit der für sie neuen Hast und Bauwut zurecht? Bei einem Besuch im Berliner Café Buchwald, das seit 120 Jahren an derselben Stelle steht, sah ich sie vor mir: die Vorväter der Betreiberfamilie in der Backstube ebenso wie die Menschen, die zu Kaiser Wilhelms Zeiten im Vorgarten des Cafés saßen.
Die Damen und Herren, Mädchen und Jungen, Großmütter und Großväter, die ihre Baumkuchenschnitten genossen und vielleicht den Sperlingen ein paar Brösel schenkten wie ich an jenem Tag. So kam mir die Idee zu diesem Roman: Ich wollte den Spuren der Vergangenheit folgen und ersann eine Familiengeschichte, die an Orten spielen sollte, die es damals wirklich gab. Das Café Buchwald erschien mir als Schauplatz ideal: ein kleines Café, das trotz übermächtiger Immobilienentwickler und Stadtplaner seinen Platz fand und ihn über Generationen behielt.
120 Jahre später ist es noch immer ein Ort für Menschen, die die Freude an süßem Kuchen, am Duft aus der Backstube, am Erschaffen von Köstlichkeiten verbindet, egal wie hektisch es draußen zugeht.“

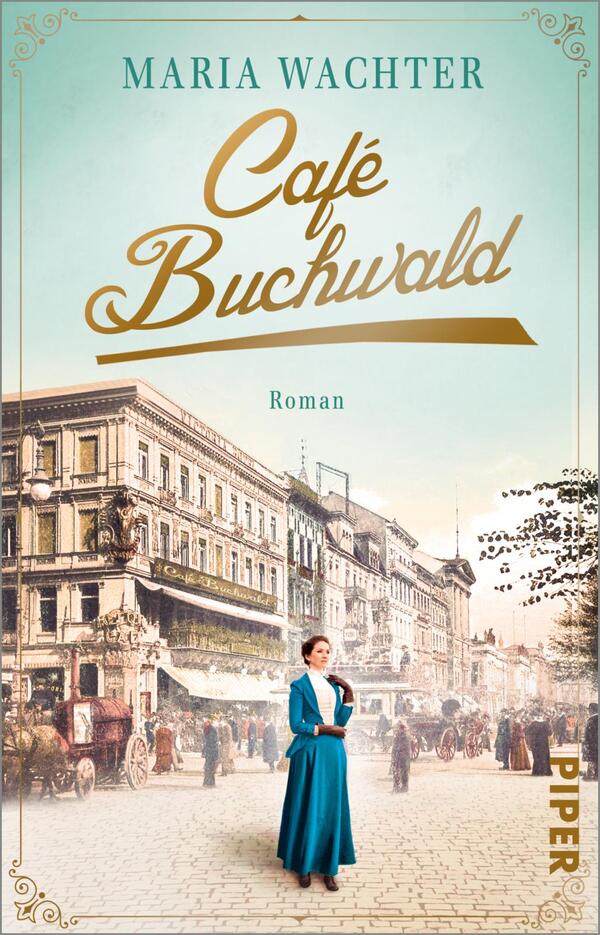
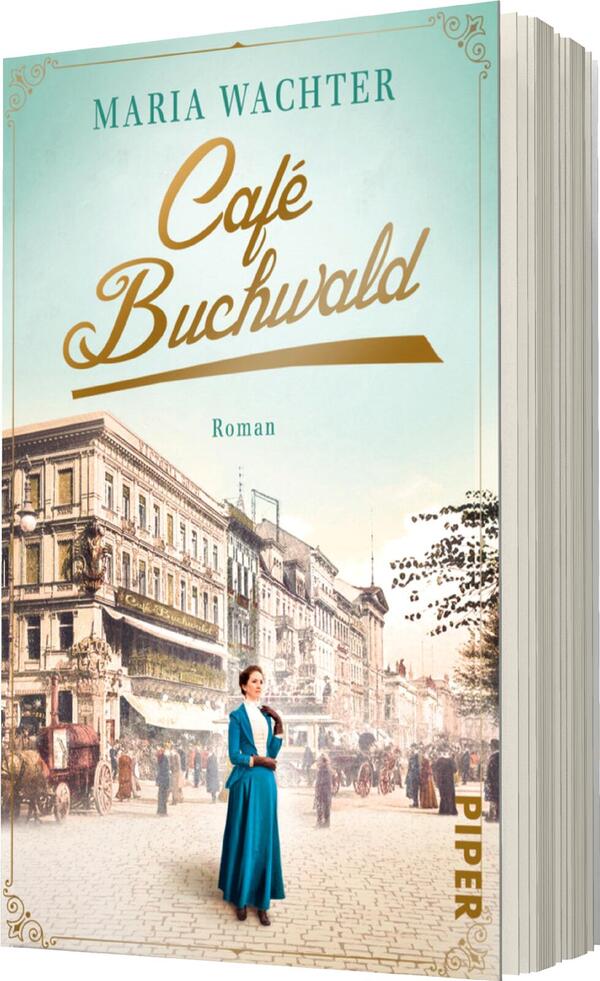
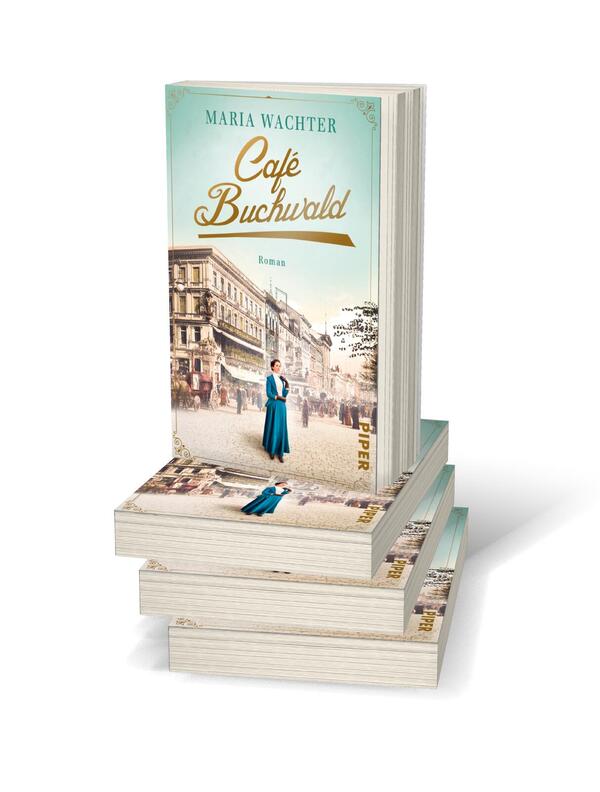
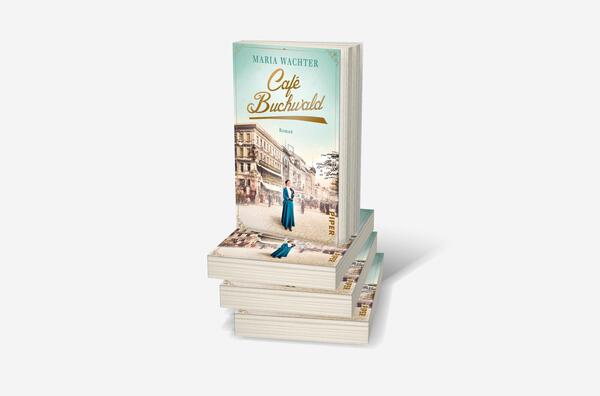

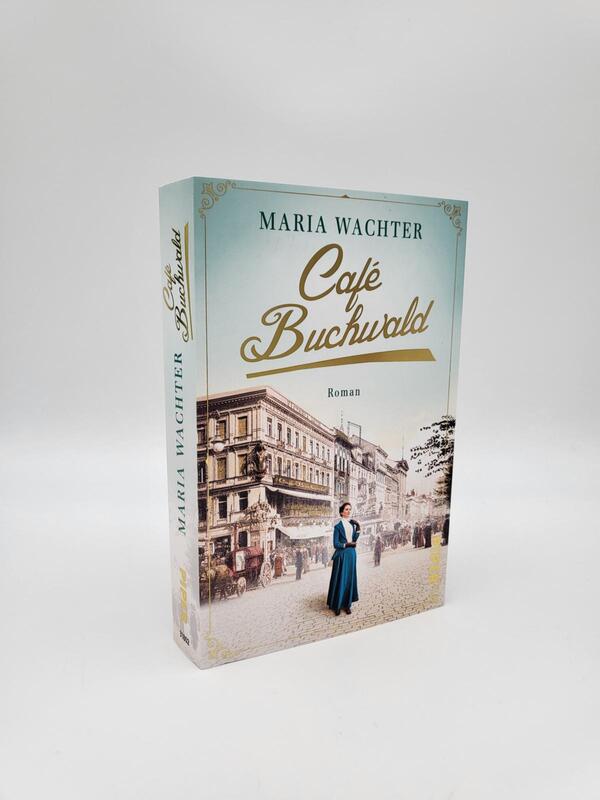






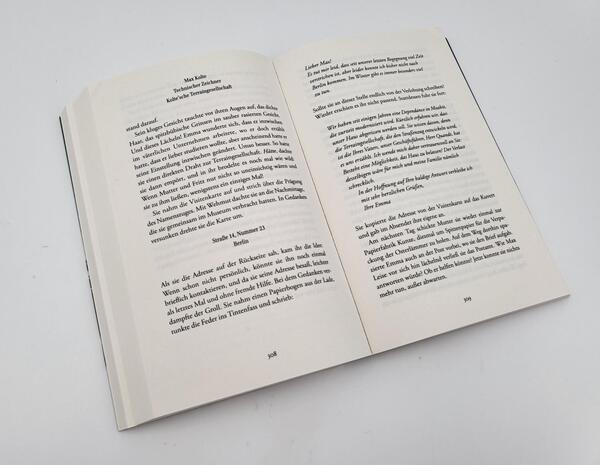



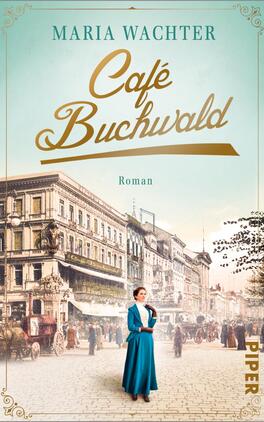
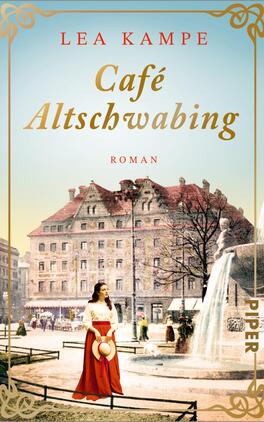



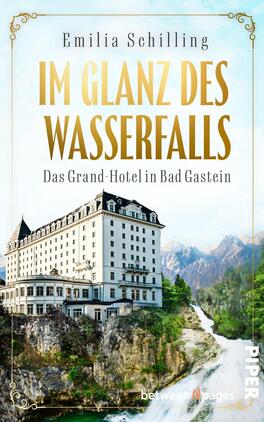
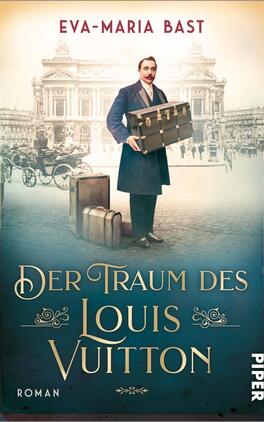
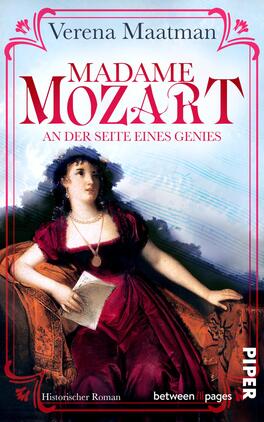











Bewertungen
des süßen Nachwerks Hochgenuss
Meinung: Die Beschreibung der Zeit von 1896 ist gut recherchiert, einfühlsam und trotzdem spannend beschrieben, wobei der Roman von Emma, ihrer Familie sowie von deren Bediensteten nebst Familien erzählt. Auch wird die reiche Familie von Max ausführlich beschrieben, wobei es der Autorin sehr gut …
Meinung: Die Beschreibung der Zeit von 1896 ist gut recherchiert, einfühlsam und trotzdem spannend beschrieben, wobei der Roman von Emma, ihrer Familie sowie von deren Bediensteten nebst Familien erzählt. Auch wird die reiche Familie von Max ausführlich beschrieben, wobei es der Autorin sehr gut gelingt, den Leser in diese Zeit hineinzuversetzen. Die Autorin schafft es mühelos, uns auch in die dunklen Ecken von Berlin zu führen. Es geht um das Café, die Liebe, aber auch um das Leben zur damaligen Zeit. Die Lebenssituationen der damaligen Zeit wurden spannend und interessant dargestellt. Es war aufregend, mit dem Roman in ganz unterschiedliche Lebenssituationen hineinzublicken. Die Protagonisten haben mir sehr gut gefallen. Auch wenn die Geschichte sehr vorhersehbar ist, gibt es doch einige kleine Überraschungen und interessante Details. Fazit: Mir hat die Geschichte gut gefallen und ich habe sie zügig gelesen. Ich konnte mit Maria lachen, weinen, hoffen, bangen und hatte das Gefühl, mit dabei zu sein, ich hatte schöne und entspannte Lesestunden und empfehle das Buch sehr gerne weiter.
Der Weg zu Berlins legendärer Konditorei "Café Buchwald"
"Café Buchwald" ist ein historischer Familienroman über die Familie Buchwald und deren Weg nach Berlin, wo sich dies bis heute noch in einem Haus an der Moabiter Brücke befindet. Die Familie Buchwald war für ihre Baumkuchen berühmt und lieferten sogar ins Schloß. Die Geschichte beginnt in Cottbus, …
"Café Buchwald" ist ein historischer Familienroman über die Familie Buchwald und deren Weg nach Berlin, wo sich dies bis heute noch in einem Haus an der Moabiter Brücke befindet. Die Familie Buchwald war für ihre Baumkuchen berühmt und lieferten sogar ins Schloß. Die Geschichte beginnt in Cottbus, wo der Familienbetrieb ansässig ist. Die Familie wird gut dargestellt. Ebenso die Bediensteten und Angestellten im Backbetrieb. Das Leben der damaligen Zeit beschreibt die Autorin sehr ausführlich. Gerade welche harte Arbeit ohne unsere jetzigen modernen Hilfsmittel da geleistet wurde. Als der Vater plötzlich verstirbt, scheint alles vorbei zu sein. Doch Emma gibt nicht auf, gerade weil die Pläne für Berlin schon anstanden und Geld investiert wurde. Als sie in Berlin Ware ausliefert, geht sie ins Museum, um für eine Zeit abzuschalten. Dort tritt sie auf den Studenten Max. Immer wieder treffen sie sich, bis ... So kommen nach und nach die Geheimnisse der Familien zu tage. Die Autorin schafft es perfekt, den Leser in das 19. Jahrhundert zu versetzen. Es ist eine interessante Zeitreise. Ich empfehle das Buch sehr gern. Und ja, bei unserem nächsten Berlin-Besuch werden wir dem Café auf jeden Fall einen Besuch abstatten.