Produktbilder zum Buch
Auf der Seidenstraße
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Vom Bosporus bis in den Himalaja – zwei Frauen auf der Reise ihres Lebens.
Schon als Teenager träumte Kate Harris davon, einmal Entdeckerin zu werden. Nach dem Studium bricht sie gemeinsam mit ihrer Freundin Mel auf, um die sagenumwobene Seidenstraße mit dem Fahrrad zu erkunden. Von Istanbul aus fahren sie entlang des Schwarzen Meers, über den eisigen Kaukasus und durch die endlosen Landschaften in Zentralasien, bis sie schließlich unerlaubt die Grenze zu Tibet passieren. Sie überqueren unzählige Pässe im Tibetischen Hochland und tauchen ein in eine Welt jenseits aller Grenzen. Ein brillantes…
Vom Bosporus bis in den Himalaja – zwei Frauen auf der Reise ihres Lebens.
Schon als Teenager träumte Kate Harris davon, einmal Entdeckerin zu werden. Nach dem Studium bricht sie gemeinsam mit ihrer Freundin Mel auf, um die sagenumwobene Seidenstraße mit dem Fahrrad zu erkunden. Von Istanbul aus fahren sie entlang des Schwarzen Meers, über den eisigen Kaukasus und durch die endlosen Landschaften in Zentralasien, bis sie schließlich unerlaubt die Grenze zu Tibet passieren. Sie überqueren unzählige Pässe im Tibetischen Hochland und tauchen ein in eine Welt jenseits aller Grenzen. Ein brillantes Buch über Sehnsüchte und Forscherdrang, über die unnatürliche politische Zerteilung der Welt und die Wildheit der Natur.
Über Kate Harris
Aus „Auf der Seidenstraße“
Prolog
Das Ende der Straße war immer gerade nicht sichtbar. Der rissige Asphalt verschmolz außer Reichweite unserer Stirnlampen mit der Nacht. Die spärlichen Strahlen wurden von der Schwärze verschluckt, die vor uns zurückwich, egal, wie schnell wir auch fuhren. Das Licht war wie ein Straßenbelag, der vor unsere Räder geworfen wurde, und die Straße ging einfach immer weiter. Ich erinnere mich, dass mir der Gedanke kam, wenn ich je das Ende erreiche, fliege ich vom Rand der Welt. Ich trat noch fester in die Pedale.
Am Vorabend hatten Melissa und ich die orangefarbenen [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Prolog
Erster Teil
Marco Polo war schuld – Nordamerika
Das Dach der Welt – Tibetisches Hochland
Naturgeschichte – England und Neuengland
Zweiter Teil
Unterströmungen – Das Schwarze Meer
Die kalte Welt erwacht – Kleiner Kaukasus
Einfallswinkel – Großer Kaukasus
Grenzlandien – Kaspisches Meer
Dritter Teil
Wildnis/Ödland – Hochplateau von Ustjurt und Aralsee-Becken
Der Ursprung eines Flusses – Pamir-Knoten
Staubkorn in einem Sonnenstrahl – Tarimbecken und Tibetisches Hochland
Am Ende der Straße – Indus-Ganges-Ebene und Himalaja
Epilog
Dank
Literaturauswahl









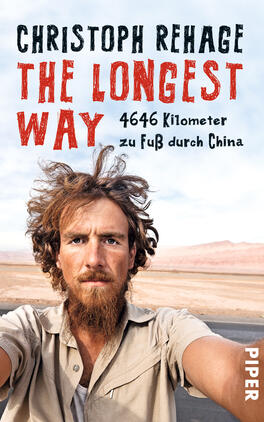






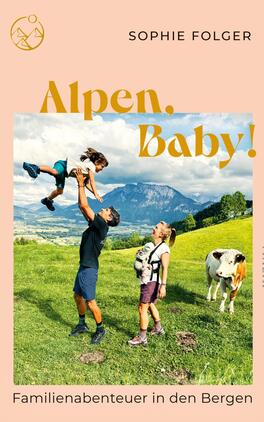





Die erste Bewertung schreiben