Zwischen Moskau und Sibieren
Russland – ein Land voller Gegensätze, Geschichte und Kultur. Ob bewegende Romane, fundierte Sachbücher oder preisgekrönte Bestseller – hier finden Sie eine vielfältige Auswahl an Büchern über Russland und Putin, die neue Perspektiven eröffnen.
Drei Gründe, die Biografie von Maria Aljochina zu lesen:
- Wer wissen will, wie Opposition in Russland wirklich aussieht, erfährt es hier aus erster Hand:
- Ein Aufruf zur gewaltfreien Revolte: Papierflieger gegen Geheimdienste, Aktionen gegen Einschüchterung. Dieses Buch inspiriert, eigene Stimmen zu erheben.
- Stoff für Debatte: Prägnante Szenen, klare Sprache und starke Zitate machen das Buch ideal, um über Freiheit, Zensur und Verantwortung zu sprechen.
Darum ist das neue Buch von Fredy Gareis so lesenswert:
- Ein seltener Blick nach Osteuropa: Dieser Reisebericht öffnet die Tür zu Estland, Lettland, Polen, Slowakei, Rumänien, Bulgarien und mehr – und zu Geschichten, die zu selten erzählt werden
- Menschen im Mittelpunkt – bewegende Begegnungen: Die persönlichen Porträts erklären mehr als jede Analyse
- Erzählt von einem ausgezeichneten Reiseschriftsteller
Das erwartet Sie im Buch von Adrian Geiges:
- Konkrete Antworten auf drängende Fragen: Was führte zum Angriff auf die Ukraine? Wie real ist ein Konflikt um Taiwan? Das Buch liefert klare Thesen und überprüfbare Befunde.
- Wie China und Russland seit 1917 historisch, ideologisch und machtpolitisch zusammenhängen – bis in die Gegenwart
- Politische Analyse - präzise recherchiert
Das erwartet Sie in „Sibiriens vergessene Klaviere”:
- Die Geschichte hinter den Instrumenten: Zarenzeit, Revolution, Exil und Gegenwart: jedes Klavier steht für ein Leben, eine Epoche, einen Ort
- Ideal für Leser:innen von Reise- und Kulturgeschichten, die neue Perspektiven suchen
- Empfohlen von Elke Heidenreich
Die Revolution hat ein weibliches Gesicht
Bücher über Russland – Literatur zwischen Geschichte und Gegenwart
Russlands weitläufigen Landschaften, die bewegte Geschichte und die vielschichtigen Menschen bieten Stoff für eindringliche Geschichten. Bücher über Russland öffnen Türen zu einer Welt voller Gegensätze – zwischen literarischen Klassikern und zeitgenössischen Analysen, zwischen persönlichen Schicksalen und großen politischen Entwicklungen.
Die Seele Russlands in der Literatur
Romane über Russland bieten tiefe Einblicke in das Land und seine Menschen. Sie erzählen von verschiedenen Epochen, von den Zarenzeiten bis zur Gegenwart und zeigen die vielschichtige Natur Russlands. Klassiker wie Fjodor Dostojewski und Leo Tolstoi sind weiterhin wichtig.




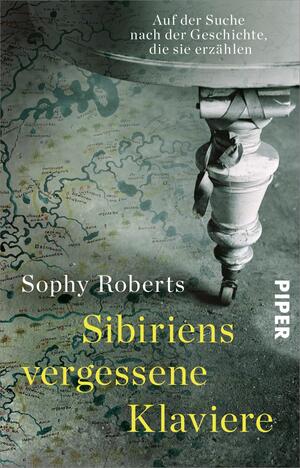

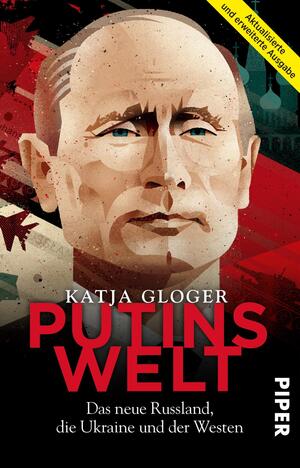
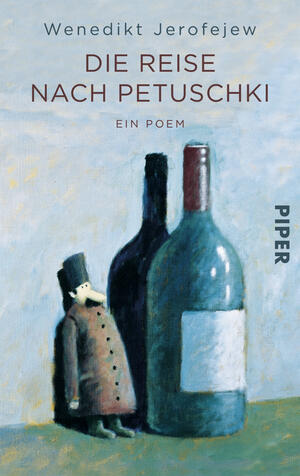


Kommentare
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.