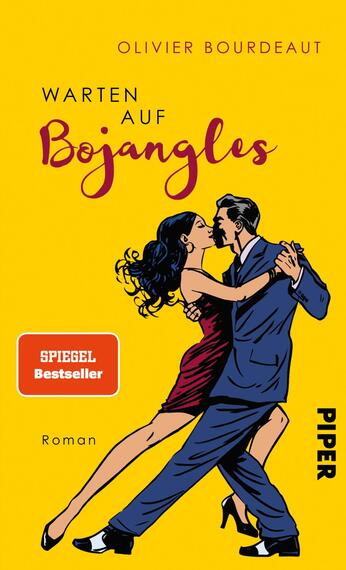
Warten auf Bojangles - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Ein furioser Roman: traurig und lustig, kraftvoll und zart. Es lohnt, den Publikumserfolg aus Frankreich zu lesen!“
plus MagazinBeschreibung
Sie tanzen zu „Mr. Bojangles“, sie mixen sich Cocktails, gemeinsam mit ihrem Sohn fahren sie in ihr Schloss nach Spanien. Sie ist charmant und charismatisch, nimmt alle für sich ein mit ihrer extravaganten Art. Georges liebt sie hingebungsvoll, die beiden feiern das Leben, wann immer es geht, denn sie kennen auch seine dunklen Momente: Georges' schillernde Frau ist manisch-depressiv. Als diese bittere Wahrheit ihr Paradies zu zerstören droht, entführen Vater und Sohn die Frau, die sie lieben, kurzerhand aus der Psychiatrie. In einem amerikanischen Oldtimer nehmen sie Kurs auf Spanien, in der…
Sie tanzen zu „Mr. Bojangles“, sie mixen sich Cocktails, gemeinsam mit ihrem Sohn fahren sie in ihr Schloss nach Spanien. Sie ist charmant und charismatisch, nimmt alle für sich ein mit ihrer extravaganten Art. Georges liebt sie hingebungsvoll, die beiden feiern das Leben, wann immer es geht, denn sie kennen auch seine dunklen Momente: Georges' schillernde Frau ist manisch-depressiv. Als diese bittere Wahrheit ihr Paradies zu zerstören droht, entführen Vater und Sohn die Frau, die sie lieben, kurzerhand aus der Psychiatrie. In einem amerikanischen Oldtimer nehmen sie Kurs auf Spanien, in der Hoffnung, dort so weiterleben zu können wie bisher. - „Warten auf Bojangles“ ist eine hinreißende Liebesgeschichte aus Frankreich, wo sie Kritiker wie Leser begeisterte und die Bestsellerlisten stürmte.
Medien zu „Warten auf Bojangles“
Über Olivier Bourdeaut
Aus „Warten auf Bojangles“
„Manche Leute werden niemals verrückt. Was für ein wirklich schreckliches Leben müssen die leben.“
Charles Bukowski
Suzon Victor für ihre kostbare Zuneigung und ihren unerschütterlichen Glauben an mich
Thomas Tournemine für seine Hilfe, seine konstruktiven Spötteleien und erhellenden Ratschläge, oder umgekehrt
Das ist meine wahre Geschichte, richtig herum und falsch herum gelogen, weil das Leben häufig so ist.
1
Vor meiner Geburt, hatte mir mein Vater erzählt, sei er mit einer Harpune auf Fliegenjagd gegangen. Er hatte mir die Harpune gezeigt und eine erlegte [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Tragisch und von wunderbarer Leichtigkeit, wie Nina Simones Hymne ›Mr. Bojangles‹, die noch lange nach dem Lesen nachklingt.“
myself„Anmutig leicht und zugleich tief berührend - mit ›Warten auf Bonjagles‹ gelingt Olivier Bourdeaut nicht nur der Überraschungsbestseller des französischen Bücherjahres, sondern eine Verheißung so süß wie das Leben. Das Buch sprüht nur so vor Charme. (…). Die Franzosen schreiben die traurig-schönsten Liebesgeschichten überhaupt.“
literaturmarkt.info„Olivier Bourdeaut hat mit ›Warten auf Bojangles‹ einen ungewöhnlichen, schönen und absolut einnehmenden Roman vorgelegt, der auf nicht einmal 160 Seiten alles auffährt, was ein Leben bereithalten kann und manchmal aushalten muss.“
feinerbuchstoff.wordpress.com„Eingepackt in eine wunderschöne Liebesgeschichte hat der Autor hier ein ernstes Thema aufgegriffen.“
Züriberg (CH)„Verstörend poetisch“
Westdeutsche Allgemeine„Es gibt sie, jene Bücher, die einem wochenlang im Kopf bleiben. Von denen man weiß, dass man sich auch noch Monate später an ihren Titel, ihre Geschichte erinnern wird. So ein Buch ist ›Warten auf Mr. Bojangles‹.“ Christine Westermann
WDR "Frau TV"„(…) eine Liebeserklärung an das Leben und ein tragisches Märchen zugleich. Man legt das Buch nicht aus der Hand.“
Südhessen Woche„Traurig und schön zugleich.“
Siegener Zeitung„160 herzerwärmende Seiten verdichtet zu einem Hohelied auf Fantasie, Tanz und ungebremste Lebensfreude. Bis das Schicksal zugreift. Zauberhaft und traurig-schön.“
Schweiz am Wochenende (CH)„Eine wunderschöne, lebensbejahende Geschichte mit viel Faible für alles Verrückte hat der Franzose Olivier Bourdeaut geschrieben – und dafür alle wichtigen Literaturpreise in Frankreich gewonnen. […] Zum Glück für alle Literaturfans liegt das Büchlein jetzt auch auf Deutsch vor.“
Ruhr Nachrichten„Olivier Bourdeaut beschreibt mit viel Fantasie ein Lebensmodell, auf das man neidisch schaut. Er bringt einen dazu, sich zu ärgern, was man doch selbst für ein Spießer ist. Bis er einem den schönen Traum brachial aus den Händen reißt.“
NEON„Ein Roman über eine wahre, tiefe Liebe.“
Meine Woche Klagenfurt (A)„Traurig und schön zugleich, leichtflüssig erzählt und mit Tiefgang.“
Liechtensteiner Woche Sonntagszeitung„Das Buch bietet ein selten köstliches Lesevergnügen.“
Kirchenzeitung für das Bistum Aachen„Es ist ein seltsamer Roman, lustig und traurig, mutmachend und verstörend, heiter und wehmütig zugleich.“
Frau und Mutter„Eine originelle und literarische Liebesgeschichte aus Frankreich, traurig und schön zugleich.“
Frankreich Magazin„Ein wunderbarer, beglückender, trauriger Roman.“
Die Rheinpfalz„Eine Entdeckung. Skurril, leicht verrückt und am Ende verstörend – mit seinem kleinen Roman ›Warten auf Bojangles‹ gelingt dem jungen französischen Autor Olivier Bourdeaut ein außergewöhnliches Debüt.“
Die Rheinpfalz„Bourdeaut gelingt es, ohne billiges Pathos, Gefühle der Sanftmut und der Hoffnung zu erwecken. Die literarische Leistung des Franzosen besteht darin, nicht allzu naiv auf die Welt zu blicken und dennoch mit Zärtlichkeit das Schicksal der psychisch kranken Mutter zu beschreiben. (…) Bourdeaut erzählt von der Kraft der Freiheit und der Liebe, selbst in den schwierigsten Zeiten des Lebens.“
BÜCHERmagazin„›Warten auf Bojangles‹ ist die Geschichte einer Achterbahnfahrt mit steilem Absturz, aber zuvor so knallvoll mit Höhen, dass dieser womöglich gar keine Rolle mehr spielt.“
Berliner Zeitung„Mit seinem Erstling ›Warten auf Bojangles‹, der jetzt eben auf Deutsch erschienen ist, landete Olivier Bourdeaut einen Volltreffer – mit einer ganz und gar unglaublichen, doch köstlichen und anrührenden Geschichte über eine durchgedrehte Familie, die nur eines will: glücklich sein.“
Basler Zeitung (CH)„Dem Franzosen Olivier Bourdeaut ist ein außergewöhnliches und hervorragendes Debüt gelungen. Die Sprache poetisch, der Aufbau spannend. Es ist ein Fest der Fantasie, ein Appell gegen Resignation und ein bemerkenswertes Plädoyer für die Liebe.“
Augsburger Allgemeine Wochenend Journal„Ein furioser Roman: traurig und lustig, kraftvoll und zart. Es lohnt, den Publikumserfolg aus Frankreich zu lesen!“
plus Magazin



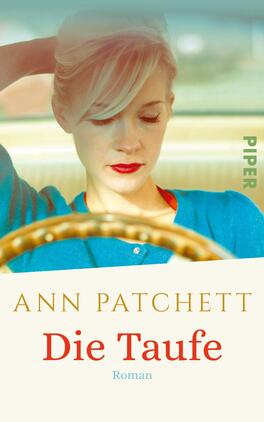
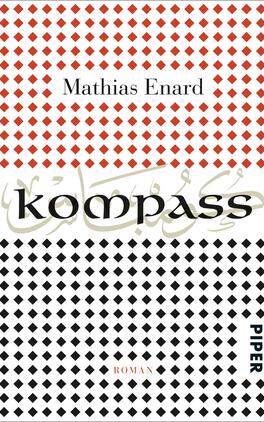
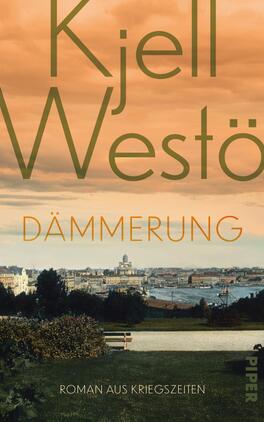
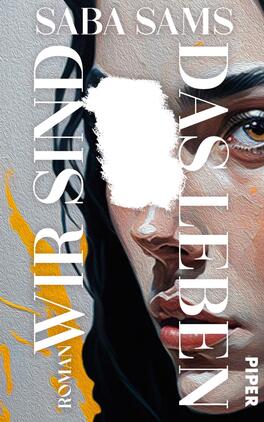
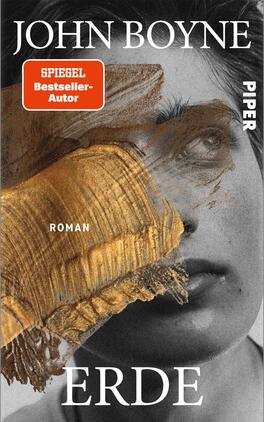
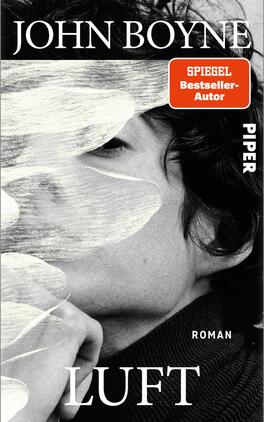
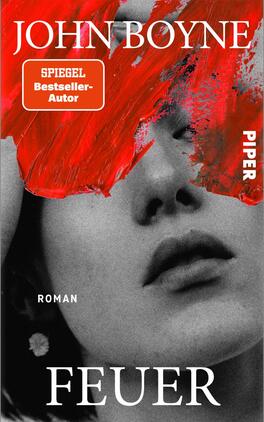
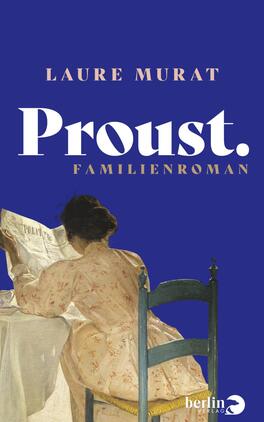
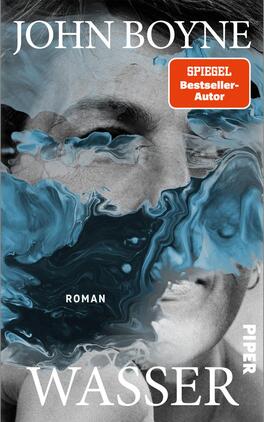
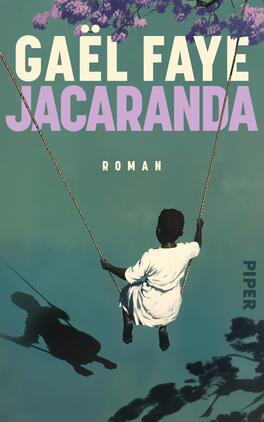
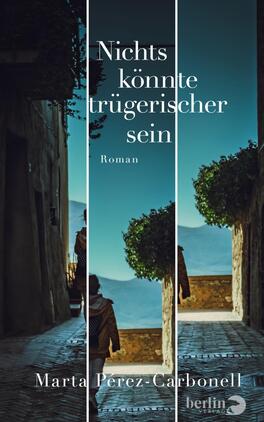
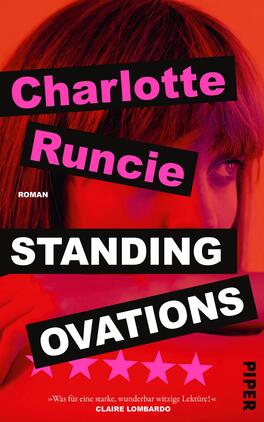
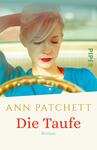
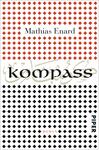
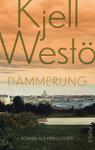
Die erste Bewertung schreiben