
Solange ich atme - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
„Die Geschichte einer willensstarken Frau, die für ihren Traum von Freiheit und fernen Ländern, das eigene Leben riskierte – und gewann.“ Süddeutsche Zeitung
Angetrieben von dem Wunsch, die Welt zu bereisen, wagt Carmen Rohrbach mit 27 Jahren die Flucht aus der DDR, im Schutz der Dunkelheit über die Ostsee. Zwei Tage und Nächte verbringt sie auf dem Wasser, in ständiger Angst, zu ertrinken oder entdeckt und verhaftet zu werden.
Ihr Fluchtversuch misslingt, doch ihr Freiheitswille bleibt ungebrochen: Nach zwei Jahren Haft im Frauengefängnis Hoheneck wird Carmen Rohrbach nach Westdeutschland…
„Die Geschichte einer willensstarken Frau, die für ihren Traum von Freiheit und fernen Ländern, das eigene Leben riskierte – und gewann.“ Süddeutsche Zeitung
Angetrieben von dem Wunsch, die Welt zu bereisen, wagt Carmen Rohrbach mit 27 Jahren die Flucht aus der DDR, im Schutz der Dunkelheit über die Ostsee. Zwei Tage und Nächte verbringt sie auf dem Wasser, in ständiger Angst, zu ertrinken oder entdeckt und verhaftet zu werden.
Ihr Fluchtversuch misslingt, doch ihr Freiheitswille bleibt ungebrochen: Nach zwei Jahren Haft im Frauengefängnis Hoheneck wird Carmen Rohrbach nach Westdeutschland ausgewiesen – und macht bald darauf als Dokumentarfilmerin und Reiseautorin die ganze Welt zu ihrer Heimat.
In „Solange ich atme“ erzählt Carmen Rohrbach ihre abenteuerliche und zutiefst inspirierende Lebensgeschichte und schildert, wie es ihr gelang, die ganze Welt zu ihrer Heimat zu machen.
Über Carmen Rohrbach
Aus „Solange ich atme“
Prolog: Flucht aus dem „Paradies“
Vor zwanzig Jahren geschah, womit niemand gerechnet hatte – die Mauer in Berlin fiel, und kurz danach existierte auch die DDR nicht mehr. Inzwischen ist die Einheit selbstverständlich geworden. Es gibt Filme und Bücher über das Leben in der DDR – sie ersetzen nicht das Gespräch, regen aber die Gedanken und die Erinnerung an. So kann das Erzählen über die Zeit vor der Wiedervereinigung als Lehrstück dienen, wie Menschen durch Ideologien manipuliert, benützt, zerstört und gebrochen werden, aber auch, wie Menschen den Mut fanden, sich [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Prolog: Flucht aus dem „Paradies“
Aufbruch
Fahrt nach Norden
Weihnachtsgans mit Folgen
Auf dem Gelände
Am Pranger
Das Paradies auf Erden
Der Urwald im Radio
Das erste Mal im Westen
An der Küste
Geheimnisvoller Rödel
Absonderung
Flucht in der Nacht
Ferienlager an der Ostsee
Frühe Liebe
Treffen der Jugend in Berlin
Abiturfahrt in die Hohe Tatra
Der Morgen im Meer
Die Kartoffeln von Desekow
Krebs und Waldmeister
Mit Kiebitz beim Vogelzählen
Sterbende Ostsee
Johannes
Hochschulreform
Die kopflosen Frösche
Der Friedhof und die „rote Uni“
Ein Schiff im Abendrot
Das Herz der Taube
Die Boje
Die polnische Jacht und das Kriegsschiff
Einzelhaft
Im Verhör
Diebstahl eines Bleistiftes
Im Namen des Volkes!
Protest des Staatsanwaltes
Putze bei der Stasi
Mit Handschellen zum Bahnhof
Gespenster auf Burg Hoheneck
Das Liebeslied des Salomo
Kinderraub
Die Knast-Akademie
Hungerstreik
Allein unter Kriminellen
Transport
Bis ans Ende der Welt
Dank





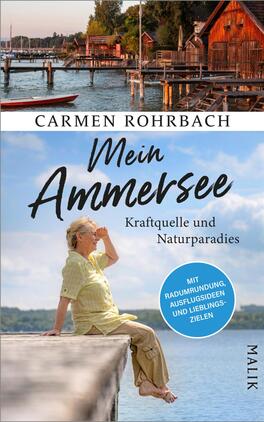
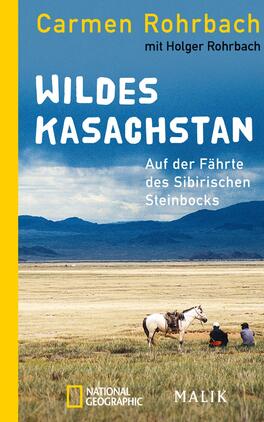



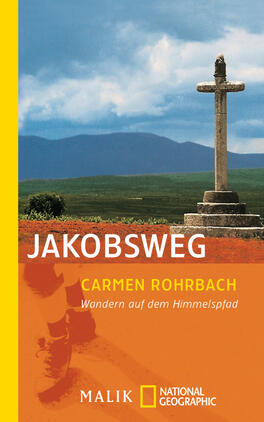

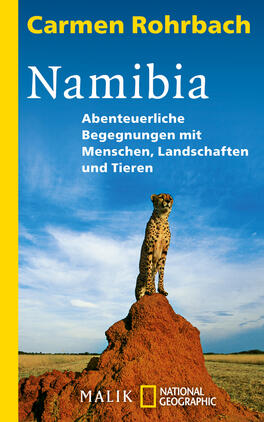
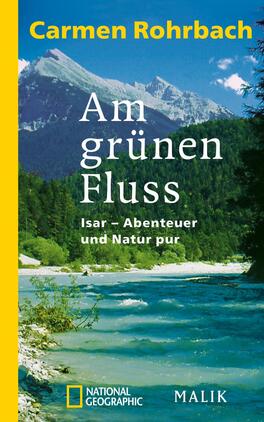





Bewertungen
Solange ich atme
Hallo liebe Carmen! Ich möchte Ihnen nur kurz ein paar Zeilen zu Ihrem Buch schreiben, weil ich einfach noch überwältigt und fertig bin. Ich danke Ihnen das Sie dieses Buch geschrieben haben. Es ist nicht zu glauben, was im Osten alles abgelaufen ist. Ich selbst habe die Ausreise mit meinen Kind…
Hallo liebe Carmen! Ich möchte Ihnen nur kurz ein paar Zeilen zu Ihrem Buch schreiben, weil ich einfach noch überwältigt und fertig bin. Ich danke Ihnen das Sie dieses Buch geschrieben haben. Es ist nicht zu glauben, was im Osten alles abgelaufen ist. Ich selbst habe die Ausreise mit meinen Kindern und Exmann mit Antrag und Schikanen erlebt, aber das grenzt ja schon an Unmenschlichkeit was Sie durchgemacht haben. Ich schreibe Ihnen mal mehr wie sehr mich dieses Buch gefesselt hat und meine Gedanken dazu,ja? Und morgen werde ich nochmal von vorne anfangen dieses Buch zu lesen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls erst einmal alles, alles Gute für Ihre weiteren Vorhaben und bleiben Sie gesund. Ihre Jutta Egener