„Eines der besten historischen Bücher des Jahres 2019“ The Times
Monatelang brandete 1945 eine Selbstmordwelle durch Deutschland, die Tausende – Frauen, Männer und Kinder – in den Untergang riss. In welchen Abgrund hatten die Menschen geblickt, dass sie angesichts der Befreiung vom Dritten Reich nur im Tod einen Ausweg sahen? Aus der Sicht derer, die das unfassbare Geschehen selbst miterlebt haben, erzählt der Historiker Florian Huber von dem größten Massenselbstmord der deutschen Geschichte und seiner Verdrängung durch die Überlebenden – ein fesselnder Blick auf die Gefühle der kleinen Leute,…
„Eines der besten historischen Bücher des Jahres 2019“ The Times
Monatelang brandete 1945 eine Selbstmordwelle durch Deutschland, die Tausende – Frauen, Männer und Kinder – in den Untergang riss. In welchen Abgrund hatten die Menschen geblickt, dass sie angesichts der Befreiung vom Dritten Reich nur im Tod einen Ausweg sahen? Aus der Sicht derer, die das unfassbare Geschehen selbst miterlebt haben, erzählt der Historiker Florian Huber von dem größten Massenselbstmord der deutschen Geschichte und seiner Verdrängung durch die Überlebenden – ein fesselnder Blick auf die Gefühle der kleinen Leute, die in ihren Untergang marschierten.
Eine unerzählte Geschichte – ein bis heute währendes Tabu
„Huber hat die Selbstlüge aufgedeckt, die zur Katastrophe geführt hat: während des ›Dritten Reichs‹, am Ende des Krieges, in der Nachkriegszeit.“ Frankfurter Allgemeine Zeitung
„In den letzten Kriegsmonaten zwischen Januar 1945 und der Kapitulation am 8. Mai brandete eine beispiellose Suizidwelle durch Deutschland. Entlang der Frontlinie und überall dort, wo die Rote Armee vorrückte, nahmen sich Zehntausende Deutsche das Leben. [...] Der Historiker Florian Huber schildert die Hintergründe der Tragödie. Auf der Grundlage von Tagebüchern, Erinnerungen und Berichten rollt er ein bisher unerzähltes und verdrängtes Kapitel deutscher Zeitgeschichte auf.“, ARD titel, thesen, temperamente,

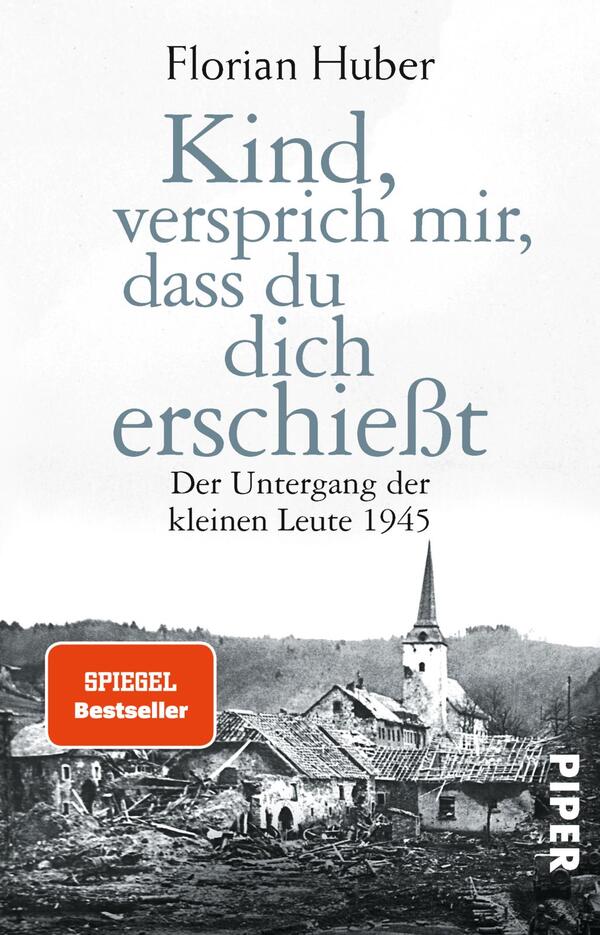








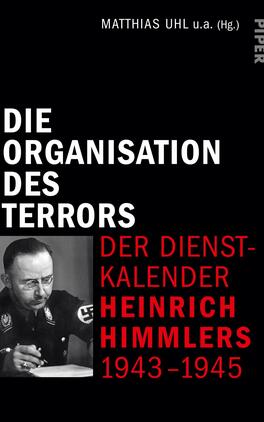
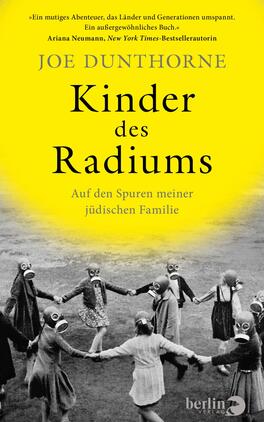




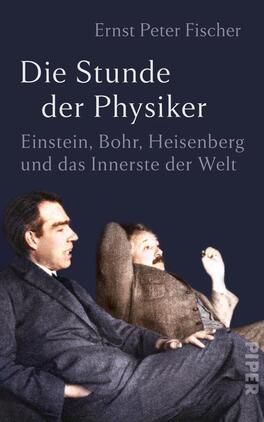

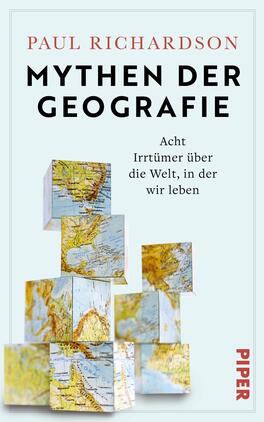






Die erste Bewertung schreiben