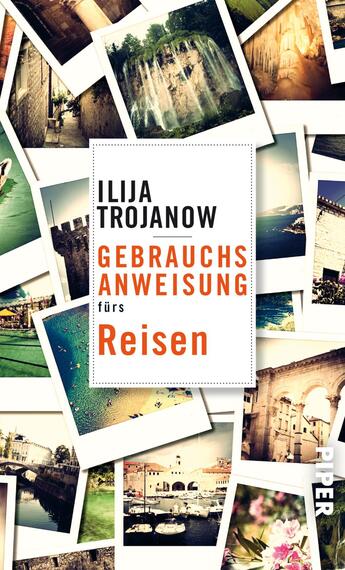
Gebrauchsanweisung fürs Reisen - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Ilija Trojanow, der weitgereiste Autor, stellt gute Fragen und gibt unterhaltsame Antworten.“
trend (A)Beschreibung
Zu Fuß oder mit dem Flugzeug, all inclusive oder solo - was suchen wir, wenn wir in andere Länder reisen? Wie viel Neues wollen wir entdecken, was hinter uns lassen, wie viel sind wir bereit zu ändern? Ilija Trojanow hat auf vier Kontinenten gelebt. Ausgehend von persönlichen Erlebnissen schreibt er über Sinn und Ertrag des Vagabundierens, verbindet profundes Reflektieren mit Lustigem und Leichtem. In einzelnen Etappen geht es um Vorbereitungen und passendes Marschgepäck, um Reisen allein oder in Gesellschaft, um den richtigen Proviant und Durststrecken unterwegs. Um Kauderwelsch und…
Zu Fuß oder mit dem Flugzeug, all inclusive oder solo - was suchen wir, wenn wir in andere Länder reisen? Wie viel Neues wollen wir entdecken, was hinter uns lassen, wie viel sind wir bereit zu ändern? Ilija Trojanow hat auf vier Kontinenten gelebt. Ausgehend von persönlichen Erlebnissen schreibt er über Sinn und Ertrag des Vagabundierens, verbindet profundes Reflektieren mit Lustigem und Leichtem. In einzelnen Etappen geht es um Vorbereitungen und passendes Marschgepäck, um Reisen allein oder in Gesellschaft, um den richtigen Proviant und Durststrecken unterwegs. Um Kauderwelsch und Wegweiser, Zimmer mit Aussicht und Souvenirs. Gekonnt spannt Trojanow den Bogen bis zum Massentourismus und zum Reisen als Kunst, die es neu zu entdecken gilt.
Über Ilija Trojanow
Aus „Gebrauchsanweisung fürs Reisen“
Mein schönstes Ferienerlebnis oder Wenn einer eine Reise tut
Der wahre Reisende hat keinen festgelegten Weg,
noch will er ans Ziel.
Lao-tse
Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mit Freunden zusammenkomme, erzählen wir uns am liebsten Geschichten von gemeinsamen Reisen. Egal, ob wir unter uns sind oder in größerer Runde. Es gibt Erlebnisse, die müssen immer wieder beschworen werden. Etwa jenes, wie wir damals durch Rabat schlenderten, am letzten Tag einer anstrengenden und nicht immer beglückenden Reise, wie wir uns überlegten, ins Kino zu gehen, wie wir [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Amüsierend und ehrlich, vor allem aber für alle Arten von Reisenden – von Anfängern bis Erfahrene Reisende – das Buch ist für alle.“
daheimistlangweilig.com„Reisen ist – wie Trojanow lesen: Engstirnigkeit geht verloren.“
Kurier (A)„Der Weltensammler und Reisephilosoph Ilja Trojanow gibt in seiner ebenso praktischen wie theorisierenden Gebrauchsanweisung Einblicke in die Kulturgeschichte des Reisens von der als Feinschliff für Adelskinder gedachten Bildungsreise über Butterfahrten bis Ballermann.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung„Seine ›Gebrauchsanweisung fürs Reisen‹ ist ebenso philosophisch wie praktisch.“
(A) Kronen Zeitung„Ilija Trojanow, der weitgereiste Autor, stellt gute Fragen und gibt unterhaltsame Antworten.“
trend (A)Inhalt
Mein schönstes Ferienerlebnis oder Wenn einer eine Reise tut
Intermezzo: Ein (Lieblings-)Ort
Eine kurze Geschichte des Reisens
Intermezzo: Ein (vergessener) Reisender
Unterwegs in zwölf Etappen
1. Stock und Hut
2. Wegweiser
3. Einsam oder gemeinsam?
Intermezzo: Eine (individuelle) Gruppenreise
4. Proviant
Intermezzo: Ein Essen (an drei Abenden)
5. Kauderwelsch
6. Gipfel
7. Gegenwind
8. Durststrecke
9. Fußläufig
Intermezzo: Ein (letztes) Foto
10. Augen auf
Intermezzo: Ein Autor (auf Reisen)
11. Pilgerschaft
12. Vor der eigenen Haustür oder In den eigenen vier Wänden
Intermezzo: Ein (sanfter) Fußabdruck
Von einem, der auszog, das Reisen zu lernen
Intermezzo: Ein (zauberhaftes) Buch
Lesetipps
Danksagung





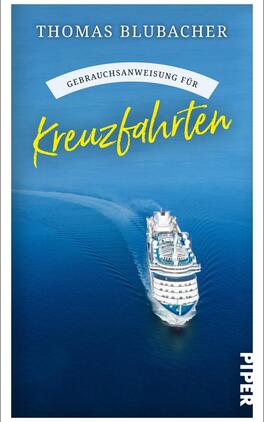

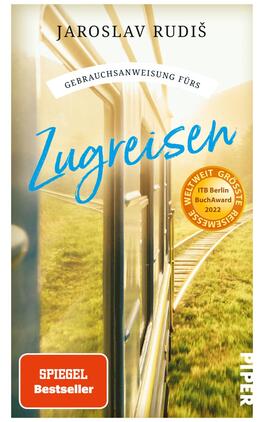


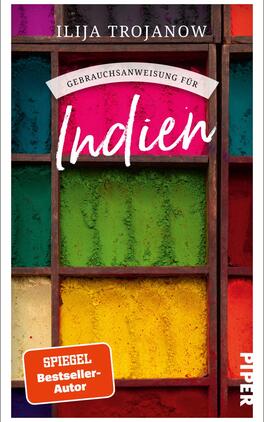
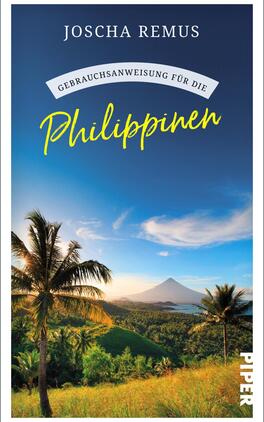

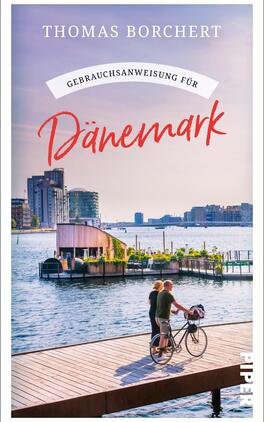
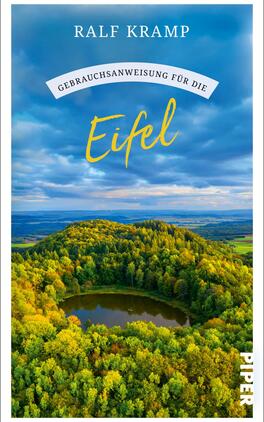
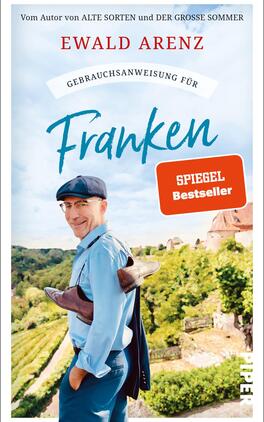



Die erste Bewertung schreiben