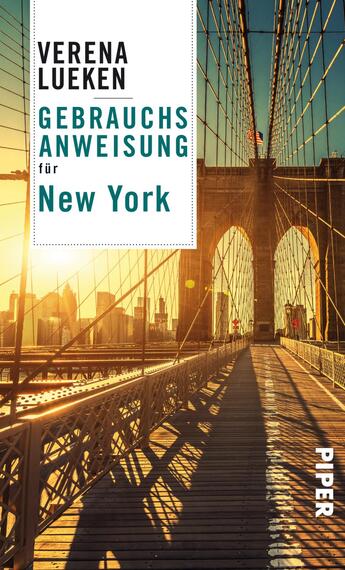
Gebrauchsanweisung für New York - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Wenn du also mehr wissen willst über Brooklyn, Harlem und SoHo, dann lass dich begeistern von diesem Buch. Du wirst ganz sicher gleich hinterher den nächsten Flug buchen wollen.“
zuckerkick.comBeschreibung
Von Frank Sinatra bis zu Woody Allen: Kein Ort wurde so oft besungen, beschrieben und verfilmt wie die Stadt, die niemals schläft. New York hat die tiefsten Schlaglöcher, die verheerendsten Stromausfälle und Mietpreise, die Ihnen die Tränen in die Augen treiben. Aber auch den berühmtesten Großstadtbahnhof, die mutigsten Radfahrer, eine noch immer atemraubende Skyline und eine enorme Vielfalt an Menschen aus über 200 Nationen. Verena Lueken zeigt uns die Stadt, in der die Welt vor der Haustür liegt und das Unerwartete zum Alltag gehört. Sie ergründet die Leidenschaft der New Yorker für alles…
Von Frank Sinatra bis zu Woody Allen: Kein Ort wurde so oft besungen, beschrieben und verfilmt wie die Stadt, die niemals schläft. New York hat die tiefsten Schlaglöcher, die verheerendsten Stromausfälle und Mietpreise, die Ihnen die Tränen in die Augen treiben. Aber auch den berühmtesten Großstadtbahnhof, die mutigsten Radfahrer, eine noch immer atemraubende Skyline und eine enorme Vielfalt an Menschen aus über 200 Nationen. Verena Lueken zeigt uns die Stadt, in der die Welt vor der Haustür liegt und das Unerwartete zum Alltag gehört. Sie ergründet die Leidenschaft der New Yorker für alles Numerische und ihren Ehrgeiz, aus der Stadt eine grüne Metropole zu machen. Und ihre Überzeugung, dass ihrer Stadt die Zukunft gehört.
Über Verena Lueken
Aus „Gebrauchsanweisung für New York“
Frühstück im Regen
Erwarten Sie, dass Ihr Leben sich verändert, wenn Sie diese Stadt betreten. Erwarten Sie nicht, dass das wie im Traum geschieht. New York ist keine Stadt für Träumer. Andere Qualitäten hat sie zuhauf. Mit dem Central Park liegt mitten in New York eine der schönsten großstädtischen Parklandschaften der Welt, und auch ohne die Zwillingstürme des World Trade Center bleibt die Skyline traumhaft. In den Museen finden Sie die erhabenste Kunst, in den Konzertsälen die Virtuosen der Welt, und auf den Straßen wird Ihnen die größtmögliche Vielfalt an [...]




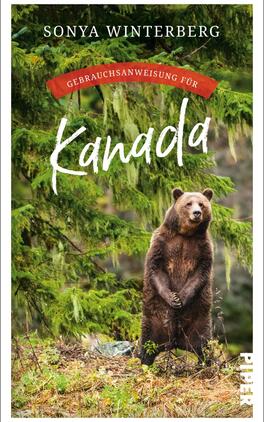

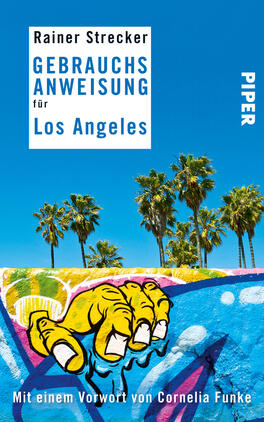
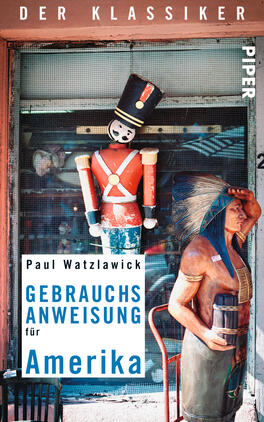
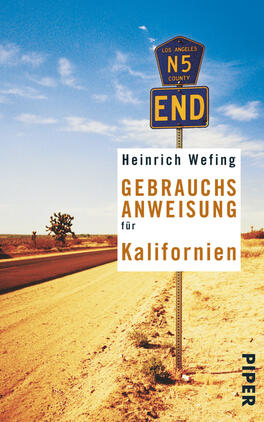
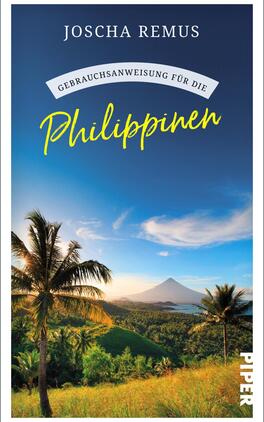

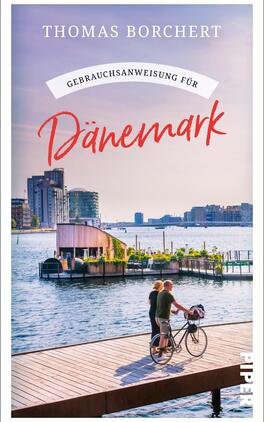
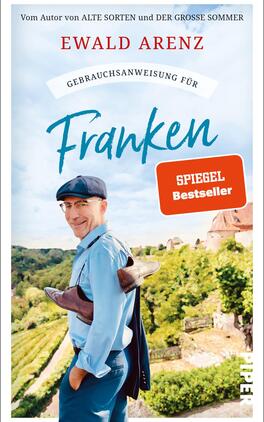
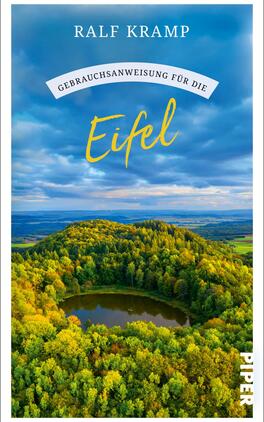
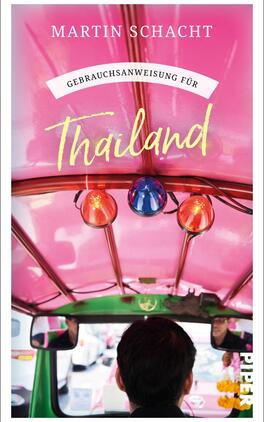
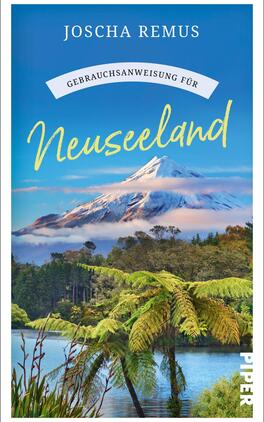



Die erste Bewertung schreiben