
Die Weiße Flamme (Die Götterkriege 2) - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Richard Schwartz erschafft eine erstaunlich komplexe Welt mit dreidimensionalen Figuren und einer unheimlich verstrickten, vielfältigen Handlung. (...) Schwartz hat auch mit diesem Roman wieder eine wunderbare Geschichte erschaffen, die sich zu lesen lohnt.“
OnlinezeitungBeschreibung
Der zweite Band der „Götterkriege“ steht im Zeichen einer uralten Verschwörung: Nach einer abenteuerlichen Reise erreicht die Halbelfe Leandra in Begleitung von Schwertmajor Blix die Kronstadt von Illian. Dort soll sie den Thron über die drei Reiche besteigen und den Menschen der seit Monaten belagerten Stadt neue Hoffnung geben. Doch Kriegsfürst Corvulus hat das Heer des Feindes vor Illian versammelt und ein schreckliches Ultimatum ausgesprochen. Schon lodern in der Kronstadt die Scheiterhaufen der Weißen Flamme, und auch Schurke Wiesel gerät zwischen die Fronten der religiösen Fanatiker.…
Der zweite Band der „Götterkriege“ steht im Zeichen einer uralten Verschwörung: Nach einer abenteuerlichen Reise erreicht die Halbelfe Leandra in Begleitung von Schwertmajor Blix die Kronstadt von Illian. Dort soll sie den Thron über die drei Reiche besteigen und den Menschen der seit Monaten belagerten Stadt neue Hoffnung geben. Doch Kriegsfürst Corvulus hat das Heer des Feindes vor Illian versammelt und ein schreckliches Ultimatum ausgesprochen. Schon lodern in der Kronstadt die Scheiterhaufen der Weißen Flamme, und auch Schurke Wiesel gerät zwischen die Fronten der religiösen Fanatiker. Leandra bleibt nur wenig Zeit, um das Schicksal Illians zu wenden, bevor sie der Ketzerei überführt und hingerichtet werden soll …
Weitere Titel der Serie „Die Götterkriege“
Über Richard Schwartz
Aus „Die Weiße Flamme (Die Götterkriege 2)“
In der Fremde
1 „Ich habe mal gedacht, ich wäre reich“, sagte Wiesel und schnitt den verschrumpelten Winterapfel in zwei Hälften. Die eine reichte er an Marla weiter. „Dieser Apfel hat mich zwei Silberstücke gekostet. Und auf dem Markt sah ich einen Jungen, der frische Ratten feilbot. Fünf Stück, gut durchgebraten und säuberlich enthaart, für eine halbe Krone.“ Die Ratte auf Marlas Schulter fiepte und legte den Kopf schief, um sich dann zu schütteln, als hätten Wiesels Worte sie erschreckt. „Man hat mich mehr als einmal einen dürren Hecht geschimpft“, fuhr Wiesel [...]













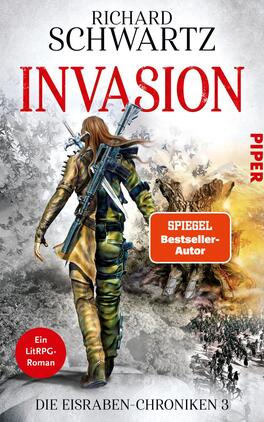


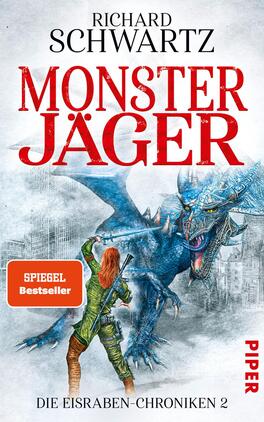









Die erste Bewertung schreiben