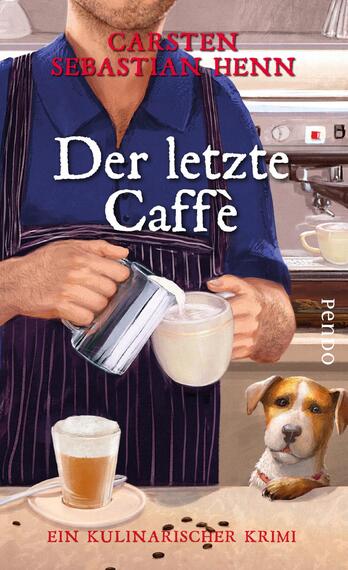
Der letzte Caffè (Professor-Bietigheim-Krimis 6) - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Ein Krimi gepaart mit viel Wissen und Aufklärung über Kaffee. Ein Reiseführer um und von Triest. Mit wunderschönen Beschreibungen und geschichtlichem Hintergrund.“
Eschborner Stadtmagazin OnlineBeschreibung
Ein Fall heißer als frisch gebrühter Kaffee
Triest – Stadt der Winde und des Kaffees. Hier soll es den besten Espresso von ganz Italien geben, der Capo Triestino ist eine stadteigene Spezialität. Eines Morgens wird auf der berühmten Piazza grande eine verkohlte Leiche gefunden. Der Tote war einer der besten Baristas der norditalienischen Hafenstadt, vier andere sind spurlos verschwunden. Doch wer hätte ein Motiv, den gefeierten Künstlern der Espressomaschinen Leid zuzufügen? Sofort wird Professor Adalbert Bietigheim zu Hilfe gerufen. Pikanterweise ist einer der verschwundenen Baristas der Mann…
Ein Fall heißer als frisch gebrühter Kaffee
Triest – Stadt der Winde und des Kaffees. Hier soll es den besten Espresso von ganz Italien geben, der Capo Triestino ist eine stadteigene Spezialität. Eines Morgens wird auf der berühmten Piazza grande eine verkohlte Leiche gefunden. Der Tote war einer der besten Baristas der norditalienischen Hafenstadt, vier andere sind spurlos verschwunden. Doch wer hätte ein Motiv, den gefeierten Künstlern der Espressomaschinen Leid zuzufügen? Sofort wird Professor Adalbert Bietigheim zu Hilfe gerufen. Pikanterweise ist einer der verschwundenen Baristas der Mann seiner großen Jugendliebe – für den sie ihn damals verlassen hat. Dennoch bezieht er bei ihrer Familie in Schloss Duino mit Foxterrier Benno Quartier, um ein im wahrsten Sinne des Wortes dunkles Verbrechen aufzuklären ...
Weitere Titel der Serie „Professor-Bietigheim-Krimis“
Über Carsten Sebastian Henn
Aus „Der letzte Caffè (Professor-Bietigheim-Krimis 6)“
Prolog
Die pechschwarze kleine Katze rieb sich am Bein von James Joyce. Auf ihrer nächtlichen Runde markierte sie stets den metallenen Schriftsteller, der auf der Brücke Ponterosso errichtet worden war. Das Wasser im Canale Grande Triests, der nur dem Namen nach groß war, schwappte gewaltig, die festgemachten Boote tanzten wild auf den Wellen, schienen sich losreißen zu wollen, um hinaus aufs Meer zu fliehen. Der starke Wind wehte unablässig, auch durch das Fell der pechschwarzen Katze, die elegant die Via Roma Richtung Piazza dell Unità d’Italia lief, den die [...]










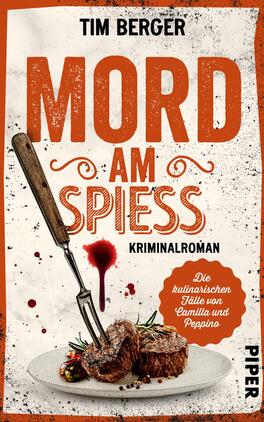





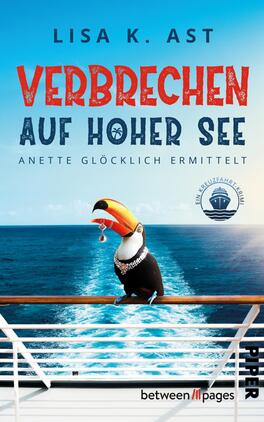



Die erste Bewertung schreiben