
Acht Wochen verrückt - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„›Acht Wochen verrückt‹ handelt zwar von Depressionen, ist aber federleicht geschrieben (…). Ohne Selbstmitleid, schlicht und ehrlich zeigt es den Weg aus der Krise (…).“
rbb Radio FritzBeschreibung
„Der Tag, an dem ich in die Klapse komme, ist ein Donnerstag“ – so beginnt Eva Lohmanns autobiographischer Roman: Ihre Heldin Mila ist müde, unendlich müde und traurig. Dabei ist sie noch keine dreißig. Aber der Jobfrisst sie auf, und der Sinn ihres Daseins ist ihr aus dem Blick geraten. Mit Depression und Burnout wird sie in eine psychosomatische Klinik eingewiesen, auch wenn das bei ihren ambitionierten Eltern alles andere als populär ist und nicht nur bei ihrem Freund eine gewisse Beängstigung auslöst. Denn niemand von denen, die an einen solchen Ort kommen, ist doch normal, oder? Aber wie…
„Der Tag, an dem ich in die Klapse komme, ist ein Donnerstag“ – so beginnt Eva Lohmanns autobiographischer Roman: Ihre Heldin Mila ist müde, unendlich müde und traurig. Dabei ist sie noch keine dreißig. Aber der Jobfrisst sie auf, und der Sinn ihres Daseins ist ihr aus dem Blick geraten. Mit Depression und Burnout wird sie in eine psychosomatische Klinik eingewiesen, auch wenn das bei ihren ambitionierten Eltern alles andere als populär ist und nicht nur bei ihrem Freund eine gewisse Beängstigung auslöst. Denn niemand von denen, die an einen solchen Ort kommen, ist doch normal, oder? Aber wie verrückt ist Mila eigentlich? Und kann man unter lauter Kranken überhaupt den Weg zurück ins richtige Leben finden?
„Acht Wochen verrückt“, der so unverstellte wie pointierte Roman über das Verrücktsein in normierten Zeiten. Von einer Erzählerin, deren scharfe Beobachtungsgabe niemanden verschont.
Medien zu „Acht Wochen verrückt“
Über Eva Lohmann
Aus „Acht Wochen verrückt“
FÜR M. L.
„Aber ich möchte nicht unter Verrückte kommen“, meinte Alice.
„ Oh, das kannst du wohl kaum verhindern “, sagte die Grinsekatze: „Wir sind hier nämlich alle verrückt. Ich bin verrückt. Du bist verrückt. “
„Woher willst du wissen, dass ich verrückt bin?“, erkundigte sich Alice.
„Wenn du es nicht wärest“, stellte die Grinsekatze fest, „dann wärest du nicht hier.“
Lewis Carroll,
Alice im Wunderland
ERSTE WOCHE Der Tag, an dem ich in die Klapse komme, ist ein Donnerstag.
Es ist früher Vormittag, und ich sitze zusammen mit vier anderen frisch Eingewiesenen auf [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Eva Lohmann lässt Mila ganz genau beobachten, schont den Leser nicht. Doch es geschieht auf ganz sanfte Art. Die Geschichte von Mila, sie berührt. Nicht nur deshalb ist dieses Buch so lesenswert“
Westdeutsche Allgemeine Zeitung„In ihrem Roman ›Acht Wochen verrückt‹ verarbeitet die Autorin, sensibel und präzise beobachtet, ihre eigenen Erfahrungen.“
Welt am Sonntag„Die geschlossene Klinik, die Eva Lohmann beschreibt hat dennoch zum Glück nichts zu tun mit ›Einer flog übers Kuckucksnest‹ (…) Ein mildes Licht scheint und lässt Lebensgefahren, Psychosen, Intrigen, Dramen mit dem Ex umso schneidender erscheinen. Das besondere: Eva Lohmann kann diese Szenen treffsicher, souverän beschreiben.“
WDR - 1Live„Ihr Roman ermöglicht mehr Verständnis für das Tabuthema, zumal sie leichthändig und nicht 'betroffen' erzählt. Zugleich macht sie spürbar, wie tief seelische Krankheit erschüttert, ermöglicht Blicke hinter die Kulissen. Lohmanns Umgang mit dem heiklen Erzählstoff ist mutig, da sie trotz der Fiktion viel von sich selber zeigt. Dabei trifft sie genau den richtigen Ton.“
WDR„Die authentische, ehrliche Art des Erzählens, mit Platz für Humor, aber nicht für Pauschalurteile, macht es zu einer spannenden, unterhaltenden Lektüre.“
Südwest Presse„Acht Wochen verrückt ist ein aufregend ehrliches Buch. Lohmann nimmt in ihren Schilderungen kein Blatt vor den Mund, schönt nichts. Und gewährt dabei spannende Einblicke. Doch nicht nur das. Lohmanns Buch macht auch nachdenklich. Zudem versteht Eva Lohmann es, ihre Geschichte in eine wunderbare Sprache zu hüllen.“
Schleswig-Holstein am Sonntag„Der autobiografisch geprägte Roman ermöglicht mehr Verständnis für ein Tabuthema, zumal Lohmann leichthändig und nicht 'betroffen' erzählt. Zugleich macht die Autorin spürbar, wie tief seelische Krankheit erschüttert, ermöglicht Blicke hinter die Kulisse. Ihr Umgang mit dem heiklen Erzählstoff ist mutig, aber sie trifft einen angemessenen Ton.“
Neue Westfälische„Lohmann beschreibt die 8 Wochen in der Klinik, ehrlich, ohne Selbstmitleid und mit viel Sympathie für die ›Gesellschaft der Irren‹.“
NDR 1„Anrührend ehrlich, ohne Selbstmitleid und ohne Belehrungen.“
NDR„Schonungslos gibt sie einen Einblick in die Gedankenwelt ihrer Protagonisten. Und sie zeigt, dass es durchaus einen Weg zurück ins Leben geben kann. Das macht Mut und ist eine beachtenswerte Reaktion auf das große Schweigen gegenüber psychischen Erkrankungen.“
Kieler Nachrichten„Eva Lohmann aus Hamburg hat einen berührenden Roman über ihre Krankheit geschrieben.“
Grazia„›Acht Wochen verrückt‹ ist leichte Lektüre über schweren Stoff: Achtsamkeit mich sich selbst zu lernen.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung„Ein beeindruckendes Roman-Debüt. (…) Lohmann beschreibt intensiv, mitfühlend und mit einer tollen Sprache.“
Flensburger Tageblatt„Es ist eine ernste Geschichte, aber Lohmann schafft es gerade zu meisterhaft, der Erzählung keine Sentimentalität aufzudrücken. Und gerade das stimmt nachdenklich. Es ist, wie es ist. Ein bemerkenswerter Stil. Sie verzichtet darauf Mitleid für die überforderte Mila zu erhaschen, sie schafft es, die Ticks der Patienten nicht ins Lächerliche zu ziehen. Ihr Humor ist fein, kommt immer dann zum Tragen, wenn auch die Figuren lachen dürfen.“
Aachener Zeitung„›Acht Wochen verrückt‹ handelt zwar von Depressionen, ist aber federleicht geschrieben (…). Ohne Selbstmitleid, schlicht und ehrlich zeigt es den Weg aus der Krise (…).“
rbb Radio Fritz



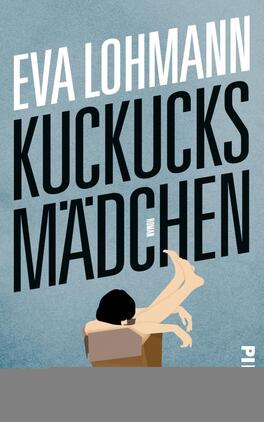

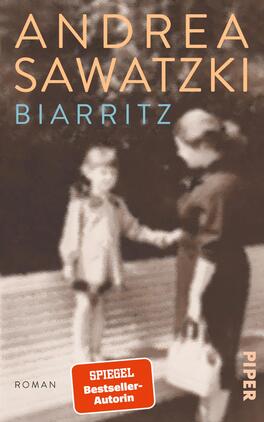
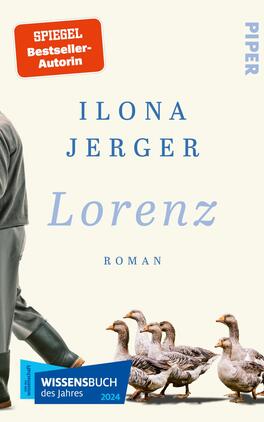
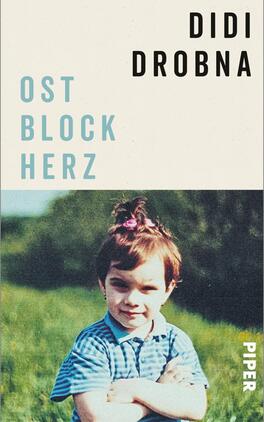

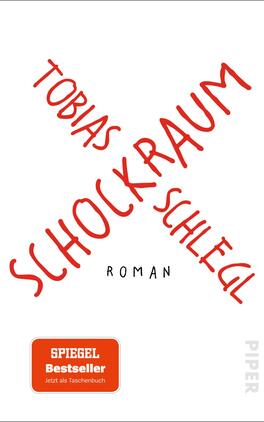








Die erste Bewertung schreiben