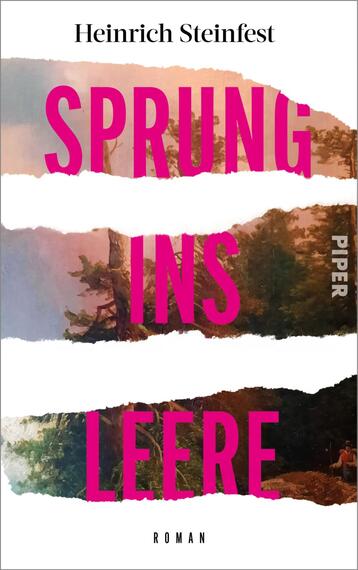
Sprung ins Leere - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Der ›Sprung ins Leere‹ ist ein großes Vergnügen“
SR2 KulturradioBeschreibung
Das Leben als Sprung ins Leere, die Kunst als Täuschung und Zufluchtsort
Klara Ingold arbeitet im Kunsthistorischen Museum in Wien. Sie ist beseelt von einer tiefen Liebe zu den Gemälden. Deshalb interessiert sie sich anders als ihre Mutter auch für die künstlerische Hinterlassenschaft ihrer ungeliebten Großmutter Helga, die die Familie 1957 ohne ein Wort verließ – und deren Werke jetzt in einer Lagerhalle wieder entdeckt werden. Darunter findet sich eine Fotografie, die einen vagen Hinweis liefert, wohin sie gegangen sein könnte. Klara Ingolds emotionale Spurensuche führt nach Japan, zu einem…
Das Leben als Sprung ins Leere, die Kunst als Täuschung und Zufluchtsort
Klara Ingold arbeitet im Kunsthistorischen Museum in Wien. Sie ist beseelt von einer tiefen Liebe zu den Gemälden. Deshalb interessiert sie sich anders als ihre Mutter auch für die künstlerische Hinterlassenschaft ihrer ungeliebten Großmutter Helga, die die Familie 1957 ohne ein Wort verließ – und deren Werke jetzt in einer Lagerhalle wieder entdeckt werden. Darunter findet sich eine Fotografie, die einen vagen Hinweis liefert, wohin sie gegangen sein könnte. Klara Ingolds emotionale Spurensuche führt nach Japan, zu einem Gemälde mit dem Titel „Die blinde Köchin“, das vielleicht ihre Großmutter zeigt.
„Heinrich Steinfest erzählt lustvoll, klug, mitreißend.“ SZ
Über Heinrich Steinfest
Aus „Sprung ins Leere“
1
Ein Mann springt in die Leere.
Eine Frau springt ins Leere.
Die Frau allerdings drei Jahre vor dem Mann.
Bloß, dass der Sprung des Mannes zu einem der ikonischen Kunstwerke einer ganzen Epoche führte.
Und die Frau?
Es geht hier gar nicht darum, dass der Sprung der Frau schlichtweg aufgrund ihres Geschlechts verschwiegen oder verdrängt wurde und also die Kunstwelt praktisch drei Jahre darauf gewartet hatte, bis endlich auch ein Mann auf die Idee kam, in die Leere beziehungsweise ins Leere zu springen. Nein, es schien einfach Pech gewesen zu sein. Vielleicht aber hatte [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Steinfest versteht es auch in dieser Geschichte, das Leben in seinen so vielfältigen Facetten zu zeigen.“
Ruhr Nachrichten„Heinrich Steinfest schreibt über Kunst. Und schafft damit selbst ein Kunstwerk. Gekonnt erzählt und sprachlich brillant nimmt es uns mit auf eine Abenteuerreise.“
(CH) SRF - Literaturclub„Der ›Sprung ins Leere‹ ist ein großes Vergnügen“
SR2 Kulturradio



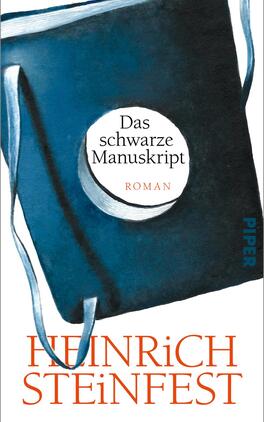
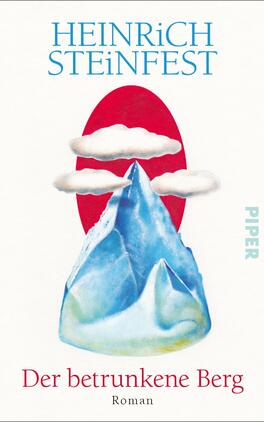
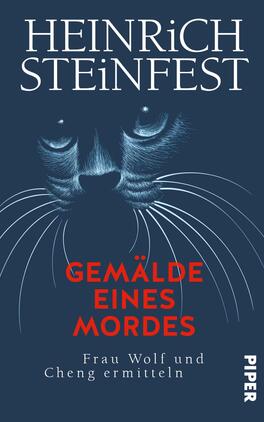
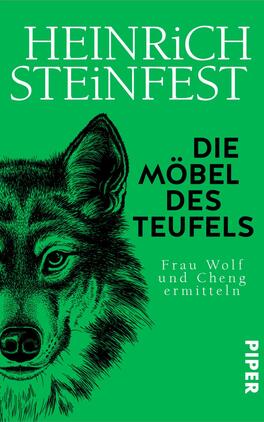
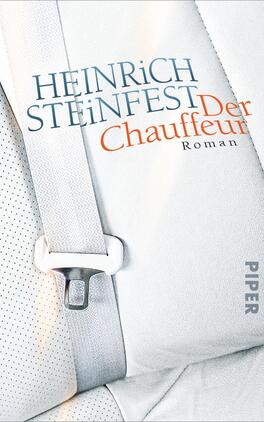
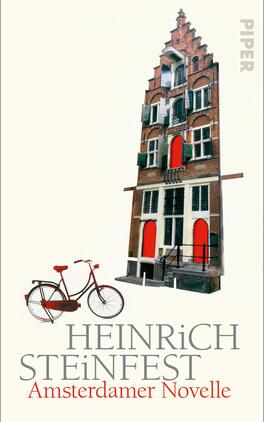
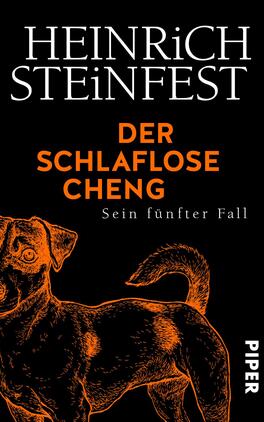
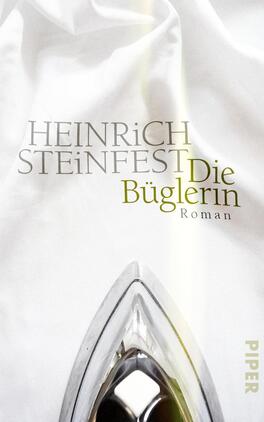
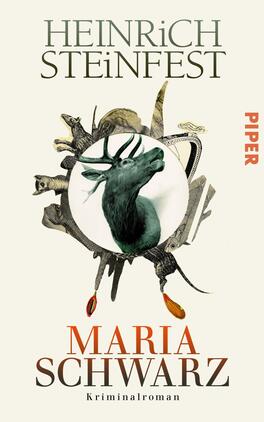
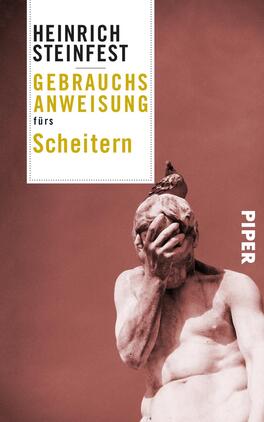
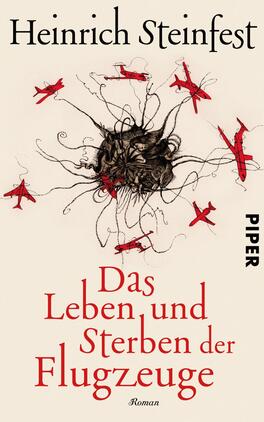
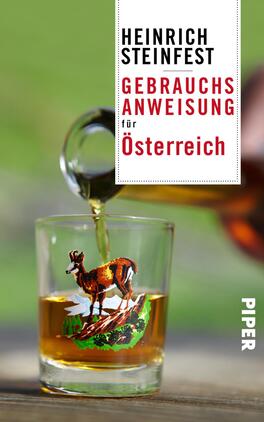


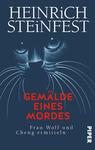
Die erste Bewertung schreiben