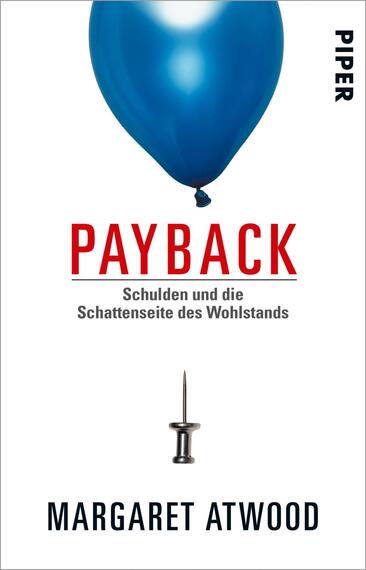
Payback
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Margaret Atwood erklärt uns mit faszinierender Klarheit, wie maßgeblich das Konzept der Schuld – im ökonomischen und im moralischen Sinn – unser Denken und Verhalten seit Anbeginn der menschlichen Kultur prägt und bestimmt. Mit Witz und Sachkenntnis verfolgt sie ihr Thema quer durch Zeiten und Disziplinen. Am Ende entlässt sie uns mit einer zentralen Frage: Was sind wir Menschen einander, was sind wir unserem Planeten schuldig?
Über Margaret Atwood
Aus „Payback“
An seinem einundzwanzigsten Geburtstag bekam Ernest Thompson Seton, kanadischer Schriftsteller und Naturforscher, von seinem Vater eine skurrile Rechnung präsentiert: eine Aufstellung aller Ausgaben, die in der Kindheit und Jugend des kleinen Ernest angefallen waren, einschließlich des Honorars für den Arzt, der ihn entbunden hatte. Noch skurriler war, dass Ernest alles bezahlt haben soll. Ich fand immer, dass Mr Seton senior ein Mistkerl war, aber inzwischen frage ich mich, was wäre, wenn er – im Prinzip – Recht hätte? Schulden wir irgendjemandem etwas aufgrund [...]





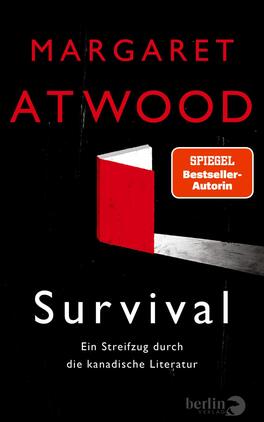

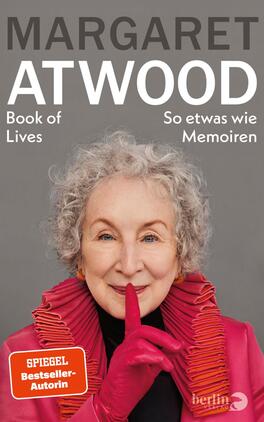
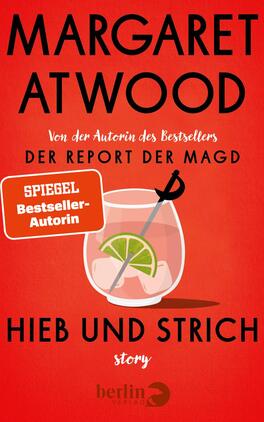


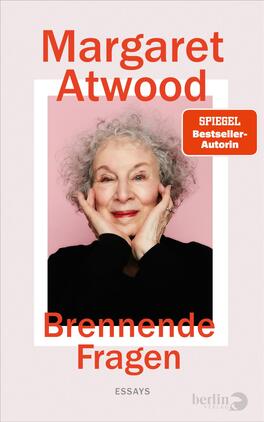
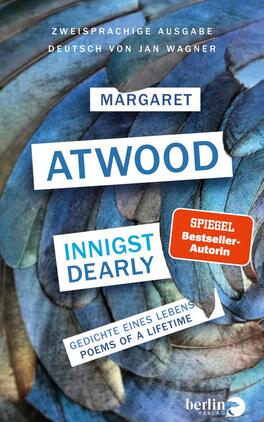
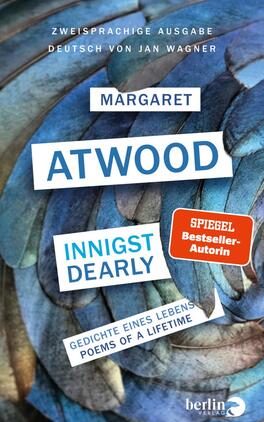

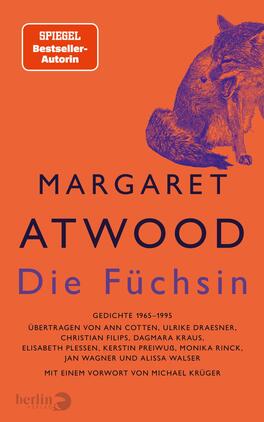
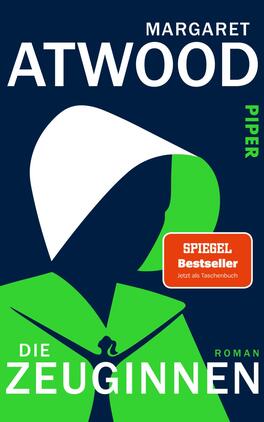



Die erste Bewertung schreiben