
Ich blieb in Auschwitz - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
1944 werden der junge niederländisch-jüdische Arzt Eddy de Wind und seine Frau Friedel nach Auschwitz deportiert. Als Häftling mit der Nummer 150822 erlebt Eddy den Terror der Nationalsozialisten am eigenen Leib: die Appelle in eisiger Kälte, die Zwangsarbeit in sengender Hitze, die Krankheiten, den Hunger, die willkürlichen Erschießungen und die Grausamkeiten, die das Lagerleben prägen. Kurz bevor die Russen das Lager im Januar 1945 befreien, wird seine Frau aus Auschwitz verschleppt, Eddy aber bleibt zurück. Wie durch ein Wunder überleben beide. Dies ist ihre Geschichte – sie wurde…
1944 werden der junge niederländisch-jüdische Arzt Eddy de Wind und seine Frau Friedel nach Auschwitz deportiert. Als Häftling mit der Nummer 150822 erlebt Eddy den Terror der Nationalsozialisten am eigenen Leib: die Appelle in eisiger Kälte, die Zwangsarbeit in sengender Hitze, die Krankheiten, den Hunger, die willkürlichen Erschießungen und die Grausamkeiten, die das Lagerleben prägen. Kurz bevor die Russen das Lager im Januar 1945 befreien, wird seine Frau aus Auschwitz verschleppt, Eddy aber bleibt zurück. Wie durch ein Wunder überleben beide. Dies ist ihre Geschichte – sie wurde geschrieben im Lager von Auschwitz. Das erschütternde Dokument wurde 1946 in den Niederlanden veröffentlicht. Nun liegt es erstmals auf Deutsch vor.
Über Eddy de Wind
Das könnte Ihnen auch gefallen
Vorwort
Ich blieb in Auschwitz.
Aufzeichnungen eines Überlebenden 1943 – 45
Anhang
Nachwort der Familie de Wind
Anmerkungen zu dieser Ausgabe






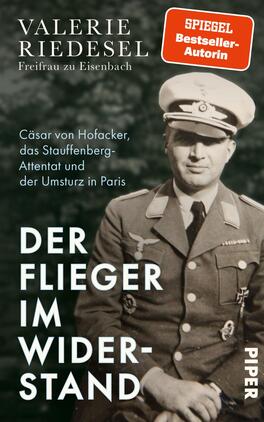

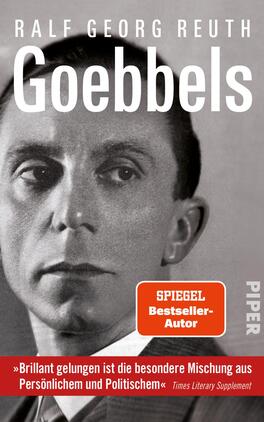
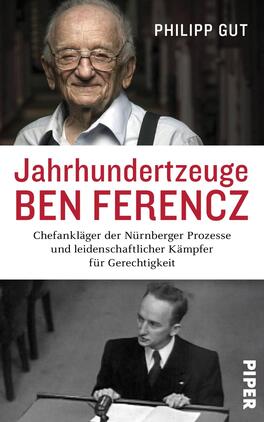

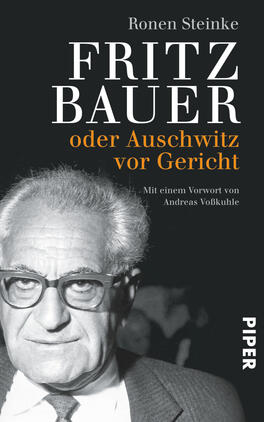
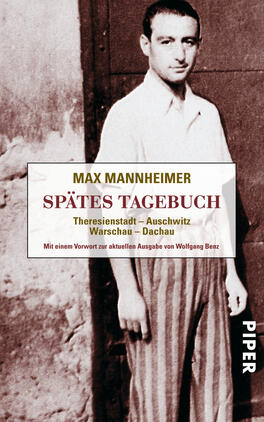
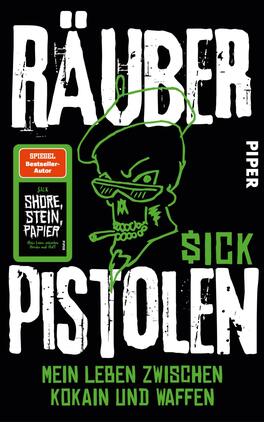
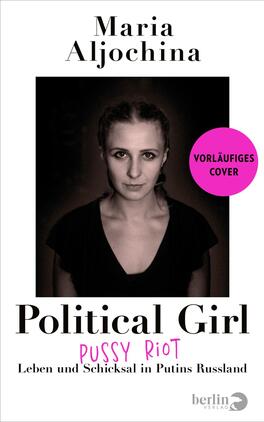
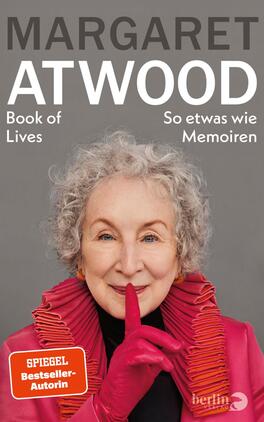



Die erste Bewertung schreiben