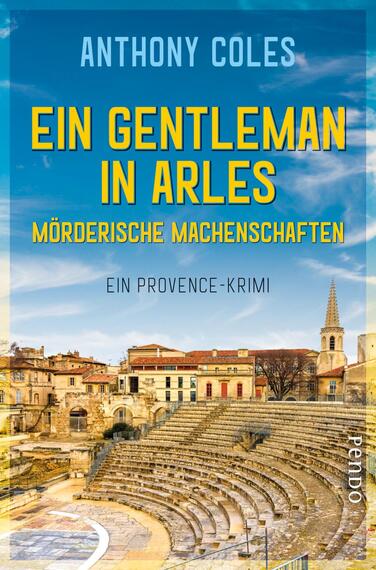
Ein Gentleman in Arles – Mörderische Machenschaften (Peter-Smith-Reihe 1) - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Bei so viel Humor, Spannung und feinstem britischen Charme hat weder die größte noch die kleinste Laus auf der Leber den Hauch einer Chance “
literatur.infoBeschreibung
Peter Smith hat ein bewegtes Leben als Unternehmensberater, Lehrer für Kunstgeschichte und britischer Geheimdienstler hinter sich und beschließt nun, in mittleren Jahren, dem verregneten England den Rücken zu kehren und sich zusammen mit seinem Windhund Arthur im schönen Arles zur Ruhe zu setzen. Schluss mit Trubel und Nebelwetter, sein knurriges Temperament sehnt sich nach Sonne, köstlichem französischem Essen und Ruhe. Doch genau die ist ihm nicht vergönnt: Kaum hat Smith das berühmte römische Amphitheater nach einem Stierkampf verlassen, wird ihm plötzlich ein Schlag auf den Hinterkopf…
Peter Smith hat ein bewegtes Leben als Unternehmensberater, Lehrer für Kunstgeschichte und britischer Geheimdienstler hinter sich und beschließt nun, in mittleren Jahren, dem verregneten England den Rücken zu kehren und sich zusammen mit seinem Windhund Arthur im schönen Arles zur Ruhe zu setzen. Schluss mit Trubel und Nebelwetter, sein knurriges Temperament sehnt sich nach Sonne, köstlichem französischem Essen und Ruhe. Doch genau die ist ihm nicht vergönnt: Kaum hat Smith das berühmte römische Amphitheater nach einem Stierkampf verlassen, wird ihm plötzlich ein Schlag auf den Hinterkopf versetzt. Als er wieder zu sich kommt, findet er sich unter einer auffallend gut gekleideten Leiche wieder. Ohne es zu wollen, stolpert er mitten hinein in einen mysteriösen Mordfall, ein Netz aus Intrigen und eine provenzalische Verschwörung ...
Weitere Titel der Serie „Peter-Smith-Reihe“
Medien zu „Ein Gentleman in Arles – Mörderische Machenschaften (Peter-Smith-Reihe 1)“
Über Anthony Coles
Aus „Ein Gentleman in Arles – Mörderische Machenschaften (Peter-Smith-Reihe 1)“
1. Tod und Wiederauferstehung
Es war viel kleiner als in seiner Erinnerung. So war es immer. Wie früher, wenn er den renommierten Lord’s Cricket Ground in London aufgesucht hatte, damals noch hartnäckig bemüht, gesellschaftsfähig zu sein. Auch der war ihm jedes Mal winzig vorgekommen wie ein Dorf-Spielfeld, obwohl auf den Tribünen achtundzwanzigtausend Zuschauer Platz fanden. Allerdings schien das Stadion im Laufe des Spiels heimlich zu wachsen, bis es zum Ende hin in seiner Wahrnehmung enorme Ausmaße angenommen hatte. Mit dem Rugbystadion in Twickenham ging es ihm [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Der Provence-Krimi ›Ein Gentleman in Arles. Mörderische Machenschaften‹ ist ein Buch mit viel echtem Lokalkolorit und eignet sich als Urlaubsbegleiter nach Südfrankreich wie auch als Herbst-Winter-Sehnsuchts-Lektüre im trüben, kalten Deutschland.“
hundimbuch.blog„Ein Buch, das einen auf intelligente Weise unterhält. (…) Großes Krimivergnügen.“
WDR 2„Höchst lesenswert.“
Südwest Presse„So vergnüglich wie eine Spritztour im Jaguar E-Type, macht wirklich Spaß.“
SWR Kultur - lesenswert Quartett„Dieser provenzalische Krimi hat es in sich“
Neue Württembergische Zeitung„Ein kultivierter Lokalkrimi.“
Frau von Heute„Bei so viel Humor, Spannung und feinstem britischen Charme hat weder die größte noch die kleinste Laus auf der Leber den Hauch einer Chance “
literatur.info


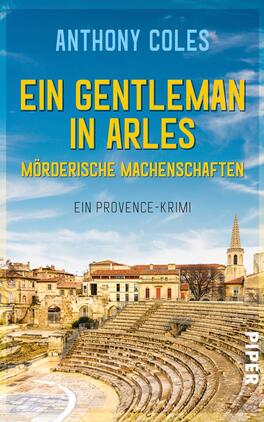
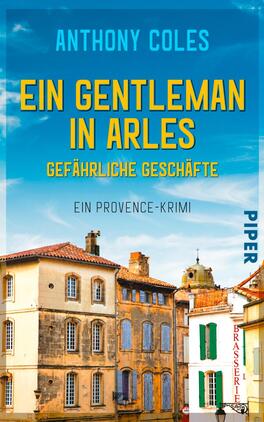
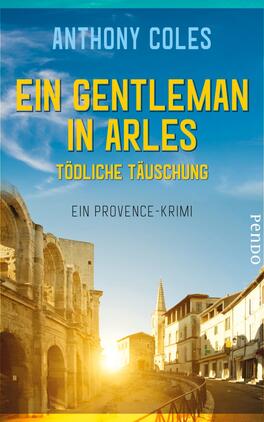
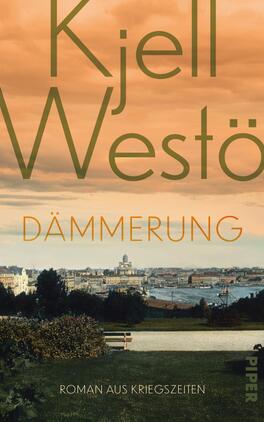


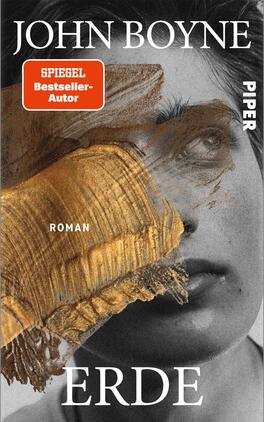
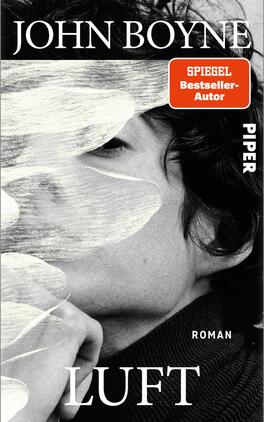

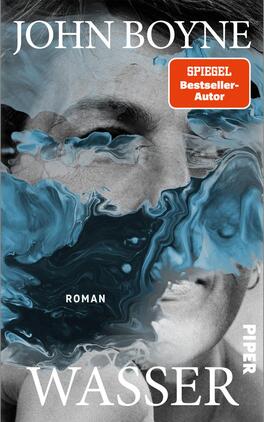
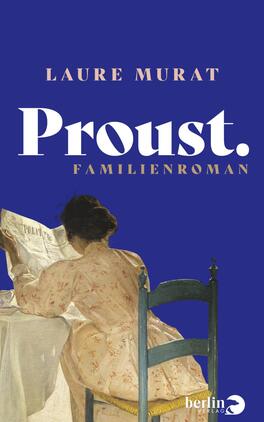

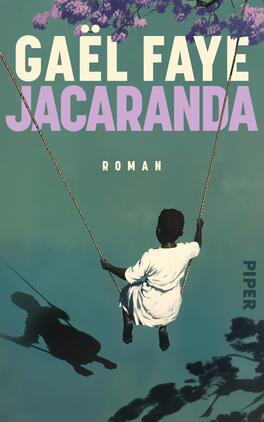



Die erste Bewertung schreiben