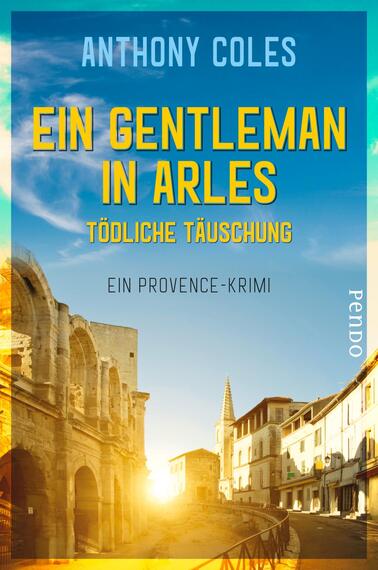
Ein Gentleman in Arles – Tödliche Täuschung (Peter-Smith-Reihe 3) - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Frankreich ist fest in den Händen rivalisierender Verbrecher: Im Südwesten herrscht Sebastien Moroni, im Südosten Alexei Girondou. Seit zwanzig Jahren agieren sie in friedlicher Koexistenz, doch nun will Moroni dies ändern und sein Gebiet auf die Camargue ausdehnen. Allerdings wollen Girondou und der größte Grundbesitzer der Gegend das nicht hinnehmen. Beide sind enge Freunde von Peter Smith und halfen ihm schon mehr als einmal bei der Lösung kniffliger Fälle. Nun ist es an der Zeit, dass Smith sich revanchiert. Als der Konflikt in der Ermordung eines jungen Toreroanwärters gipfelt, beginnt…
Frankreich ist fest in den Händen rivalisierender Verbrecher: Im Südwesten herrscht Sebastien Moroni, im Südosten Alexei Girondou. Seit zwanzig Jahren agieren sie in friedlicher Koexistenz, doch nun will Moroni dies ändern und sein Gebiet auf die Camargue ausdehnen. Allerdings wollen Girondou und der größte Grundbesitzer der Gegend das nicht hinnehmen. Beide sind enge Freunde von Peter Smith und halfen ihm schon mehr als einmal bei der Lösung kniffliger Fälle. Nun ist es an der Zeit, dass Smith sich revanchiert. Als der Konflikt in der Ermordung eines jungen Toreroanwärters gipfelt, beginnt Smith zu ermitteln, nicht nur um den Tod des jungen Mannes aufzuklären, sondern auch um der Fehde der beiden Ganoven ein Ende zu setzen.
Weitere Titel der Serie „Peter-Smith-Reihe“
Über Anthony Coles
Aus „Ein Gentleman in Arles – Tödliche Täuschung (Peter-Smith-Reihe 3)“
Prolog
„Ich hätte einen Job für Sie. Und würde Ihnen eine Million Dollar zahlen.“
Der junge Mann sah sich einem elegant gekleideten Mann gegenüber, der sich unaufgefordert zu ihm an den Tisch gesetzt hatte.
„Worum geht’s?“
„Sie sollen mir helfen, jemanden zu töten.“
„Wen?“
„Meinen Bruder.“
Der junge Mann verzog keine Miene, als ihm der Fremde eine Visitenkarte zuschob: „Melden Sie sich.“ Dann verließ er das Café.
1. Vorgeplänkel
Der Strand von La Plagette war wie viele, wenn nicht wie die meisten Strände dieser Region. Er bestand aus einem schmalen, sauberen Sandstreifen [...]



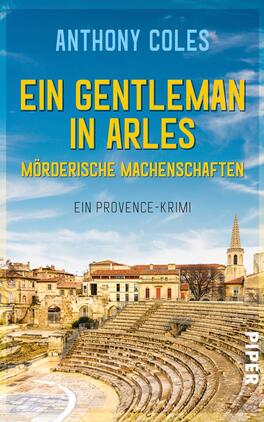
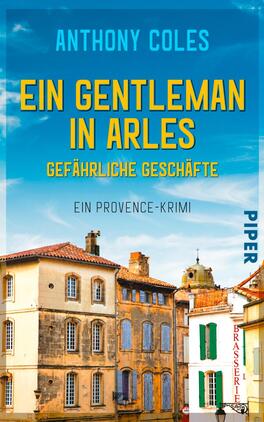
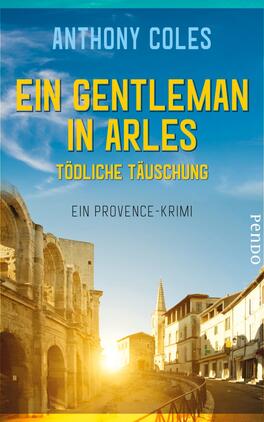






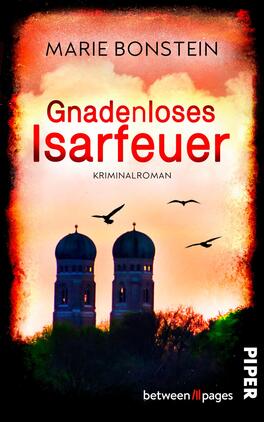






Die erste Bewertung schreiben