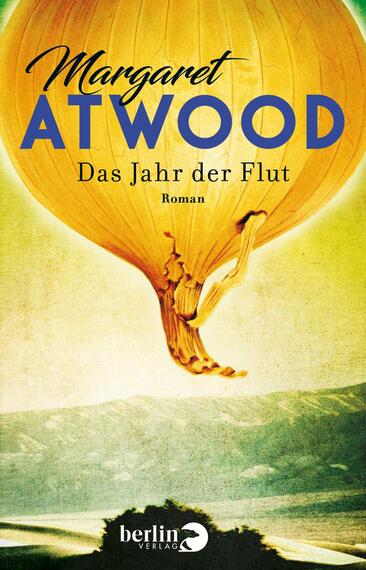
Das Jahr der Flut - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Es ist das Jahr der „wasserlosen“ Flut: Eine tödliche Pandemie ist über die Menschheit hereingebrochen. Hoch über den Dächern der Stadt leben die wenigen Überlebenden, die Gottesgärtner, bei denen die robuste Toby und die zarte Prostituierte Ren Zuflucht gefunden haben. In ihrem biologisch bepflanzten Garten Eden kämpfen sie ums Überleben in einer Welt, die unter der Herrschaft verantwortungsloser Großkonzerne zugrunde gegangen ist. Eine Zukunftsvision, die vielleicht weniger fern liegt, als wir gerne glauben möchten.
Über Margaret Atwood
Aus „Das Jahr der Flut“
1.Toby. Jahr Fünfundzwanzig, das Jahr der Flut
Früh am Morgen klettert Toby aufs Dach, um sich den Sonnenaufgang anzusehen. Sie stützt sich auf den Stiel eines Wischmops: Der Fahrstuhl hat schon seit längerem den Geist aufgegeben, die Hintertreppe ist glatt vor Nässe, und wenn sie ausrutscht und hinfällt, ist niemand da, der ihr wieder aufhilft. Als die erste Hitze aufkommt, steigt Nebel aus dem breiten Baumstreifen hoch, der zwischen ihr und der verfallenen Stadt liegt. Die Luft riecht leicht verbrannt, nach Karamell und Tee und ranzigem Grill, und brennender [...]




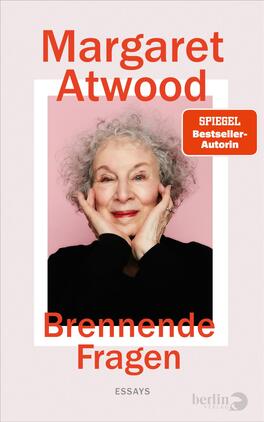
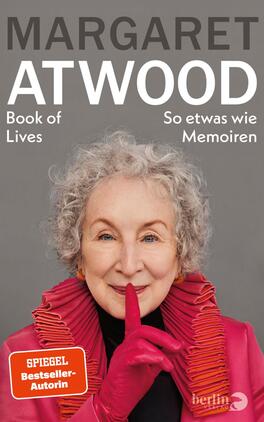
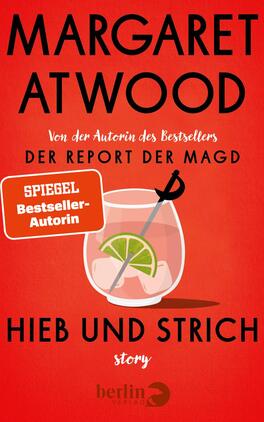


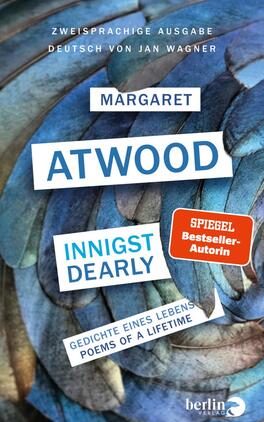
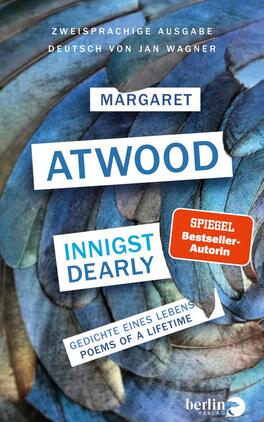

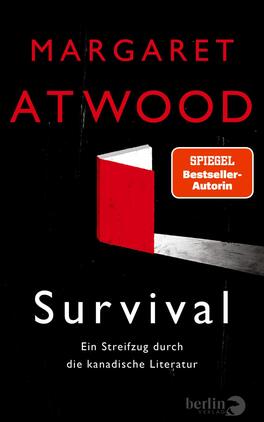
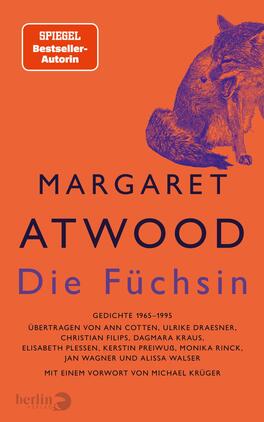
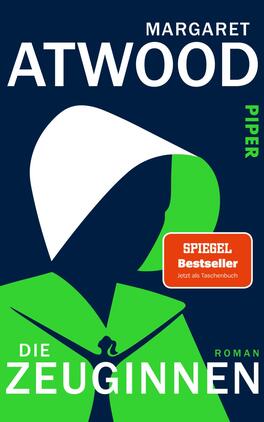

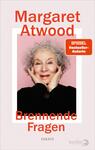


Die erste Bewertung schreiben