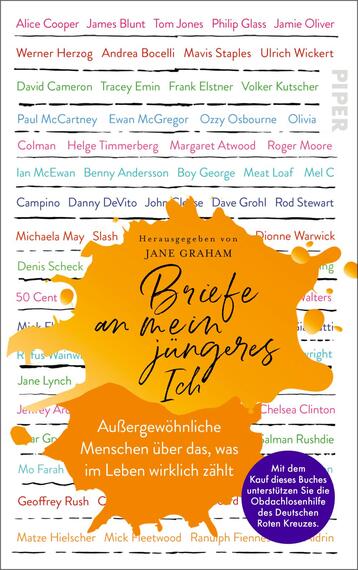
Briefe an mein jüngeres Ich - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
„Mein jüngeres Ich wäre erstaunt über mein Leben!“
Was würden Sie Ihrem 16-jährigen Ich heute sagen? Würden Sie ihm erzählen, was Sie inzwischen alles gelernt haben über die Liebe, das Leben und den Tod? Die Größen aus Kunst, Kultur und Politik machen es in diesem Buch vor: Sie erinnern sich an ihre Jugend – an Sorgen und Ängste, Hoffnungen und Freuden – und malen sich aus, was sie ihrem früheren Ich raten würden. Die klugen Antworten und berührenden Geschichten bewegen nicht nur, sie sind auch wunderbare Lektionen, die uns liebevoll darauf hinweisen, mit sich und dem Leben nicht allzu streng…
„Mein jüngeres Ich wäre erstaunt über mein Leben!“
Was würden Sie Ihrem 16-jährigen Ich heute sagen? Würden Sie ihm erzählen, was Sie inzwischen alles gelernt haben über die Liebe, das Leben und den Tod? Die Größen aus Kunst, Kultur und Politik machen es in diesem Buch vor: Sie erinnern sich an ihre Jugend – an Sorgen und Ängste, Hoffnungen und Freuden – und malen sich aus, was sie ihrem früheren Ich raten würden. Die klugen Antworten und berührenden Geschichten bewegen nicht nur, sie sind auch wunderbare Lektionen, die uns liebevoll darauf hinweisen, mit sich und dem Leben nicht allzu streng ins Gericht zu gehen.
„Ein nachdenkliches, lustiges und bewegendes Buch.“ The National Scot
„Wie alle guten Ideen ist auch diese einfach. Berühmte Menschen, von Hollywood-Stars bis zu Sporthelden, wurden gefragt, was sie der jüngeren Version von sich selbst sagen würden. Die Antworten sind eine großartige Lektüre.“ Sunday Mirror
„Diese Sammlung ist voll von aufschlussreichen Geschichten, die Sie dazu bringen werden, darüber nachzudenken, wie Sie Ihr eigenes Leben leben und wie Sie es in Zukunft leben wollen.“ Woman's Weekly
Aus „Briefe an mein jüngeres Ich“
John Bird
Mitgründer des Big Issue
Der Ratschlag, den ich meinem jüngeren Ich geben würde, lautet: „Lass dich nicht erwischen.“ Denn mit meinen sechzehn Jahren saß ich im Gefängnis – ich hasste die ganzen staatlichen Einrichtungen und die Zwangsgemeinschaft mit den Jungs. Ich hasste Jungs; ich hasste ihr Leben, ihren Geruch und das, womit sie sich beschäftigten. Mädchen dagegen liebte ich so sehr, dass ich trauerte. Nicht, weil ich Unrecht getan hatte, sondern weil ich mich der Anwesenheit von Mädchen beraubt hatte.
Jungs mochte ich außerdem deshalb nicht, weil sie [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Vorwort
John Bird
Billie Jean King
Alice Cooper
James Blunt
Melanie C
Mo Farah
Tom Jones
Frank Elstner
Mary J. Blige
Philip Glass
Rufus Wainwright
Shania Twain
Werner Herzog
Val McDermid
Andrea Bocelli
Imelda Staunton
Jeffrey Archer
John Lithgow
Volker Kutscher
Mavis Staples
Desmond Tutu
Julie Walters
Michael Palin
Viggo Mortensen
Campino
Chelsea Clinton
Bear Grylls
David Cameron
David Tennant
Joanna Lumley
Dionne Warwick
Roger Daltrey
will.i.am
Matze Hielscher
Olivia Newton-John
Jamie Oliver
Tracey Emin
Mary Robinson
Ulrich Wickert
Jane Lynch
Ranulph Fiennes
Salman Rushdie
Malcolm McDowell
James Earl Jones
Buzz Aldrin
Danny DeVito
Michaela May
Ewan McGregor
Ozzy Osbourne
Paul McCartney
Geoffrey Rush
Chrissie Hynde
Marianne Faithfull
Ian Rankin
Margaret Atwood
Roger Moore
Helge Timmerberg
Ian McEwan
Slash
Benny Andersson
Boy George
Meat Loaf
Mick Fleetwood
Mary Beard
Denis Scheck
Colm Tóibín
Harry Shearer
John Lydon
Paul Giamatti
Rod Stewart
Arianna Huffington
E. L. James
50 Cent
John Cleese
Neil Gaiman
Olivia Colman
Dave Grohl
Wilko Johnson



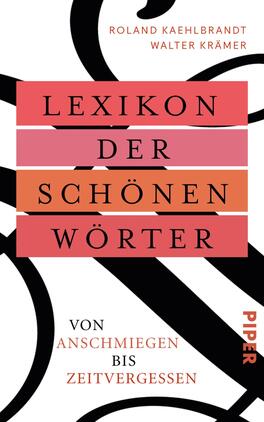




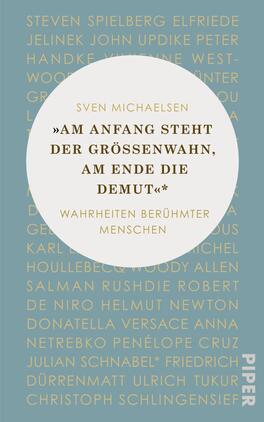

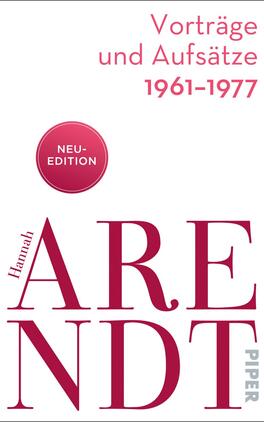







Die erste Bewertung schreiben