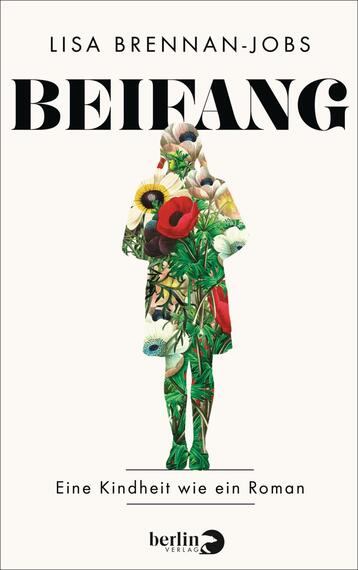
Beifang - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„›Beifang‹ kann sicher dabei helfen, das Mysterium Steve Jobs etwas auszuleuchten. Doch ist das Buch auch eine universelle Erzählung von einem Mädchen, das ohne einen zuverlässigen Vater aufgewachsen ist - der in diesem einen Fall eben ein Milliardär war.“
Süddeutsche ZeitungBeschreibung
„Achtundzwanzig Prozent der männlichen Bevölkerung der USA könnten der Vater sein.“ Das sagte Steve Jobs dem Time Magazine über seine Tochter Lisa. Für die Öffentlichkeit war er da schon ein Halbgott. Was bedeutet es, einen Vater zu haben, der lange nichts von einem wissen wollte? Behutsam nähert Lisa Brennan-Job sich dieser für sie brennenden Frage und versucht mit ihren Kindheitserinnerungen Antworten zu finden. Aber, anders als von vielen erhofft, ist es keine gehässige Abrechnung mit dem Apple-Guru geworden, sondern ein kluges und berührendes Buch über die Liebe zwischen Eltern und…
„Achtundzwanzig Prozent der männlichen Bevölkerung der USA könnten der Vater sein.“ Das sagte Steve Jobs dem Time Magazine über seine Tochter Lisa. Für die Öffentlichkeit war er da schon ein Halbgott. Was bedeutet es, einen Vater zu haben, der lange nichts von einem wissen wollte? Behutsam nähert Lisa Brennan-Job sich dieser für sie brennenden Frage und versucht mit ihren Kindheitserinnerungen Antworten zu finden. Aber, anders als von vielen erhofft, ist es keine gehässige Abrechnung mit dem Apple-Guru geworden, sondern ein kluges und berührendes Buch über die Liebe zwischen Eltern und Kindern - allen Widrigkeiten zum Trotz.
Lisa war das Ergebnis einer schon im Ansatz gescheiterten Liebe. Als die Studentin Chrisann Brennan schwanger wurde, hatte Steve Jobs hatte gerade das College geschmissen und schraubte in der berühmten Garage im Silicon Valley komische Kästen zusammen. Chrisann wollte Künstlerin werden und verließ den "Nerd" Steve. Diese Kränkung sollte er ihr - und auch Lisa - lange nicht verzeihen. Der Apple-Gründer bestritt die Vaterschaft, nannte aber gleichzeitig wohl einen seiner Computer nach ihr. Und das kleine Mädchen erlebte eine Kindheit der Extreme: Da war einerseits ihre Hippie-Mutter, die nicht einmal genug Geld für ein Sofa hatte, und andrerseits eben einer der reichsten und berühmtesten Männer der Welt … Herzzerreißend und komisch – eine Kindheit, die man so nie erfinden könnte.
„Ein zauberhaftes, berührend intimes Porträt, eine Geschichte aus der Sicht einer Tochter, deren Vater mit seinen eigenen Wurzeln zu kämpfen hatte - und der doch beinahe zu dem Vater wurde, den sie sich gewünscht hätte.“ ―Susan Cheever
Über Lisa Brennan-Jobs
Aus „Beifang“
HIPPIES
Als ich sieben wurde, waren meine Mutter und ich schon dreizehnmal umgezogen.
Mal wohnten wir im möblierten Schlafzimmer einer Freundin, mal vorübergehend bei irgendwem zur Untermiete, immer inoffiziell. Die letzte Wohnsituation war ungeeignet geworden, als jemand ohne Vorwarnung den Kühlschrank verkauft hatte. Am nächsten Tag rief meine Mutter meinen Vater an, bat um mehr Geld, und er erhöhte die Unterhaltszahlungen um zweihundert Dollar pro Monat. Wir zogen erneut um, ins Erdgeschoss eines kleinen Gebäudes hinter einem Haus in der Channing Avenue in Palo [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„›Beifang‹ ist ein lesenswertes Buch für Menschen, (…) für die Steve Jobs kein beliebiger Prominenter, sondern eine Persönlichkeit von großer zeithistorischer Bedeutung ist.“
Kulturradio rbb„Auf dem Sterbebett habe er sich tränenreich bei ihr entschuldigt, berichtet sie am Ende. Aber da war es zu spät, um sie davon abzuhalten, ihre traumatische Kindheit und Jugend mit einem der berühmtesten Väter der Welt in einem sehr lesenswerten Buch aufzuarbeiten.“
Handelsblatt„Der Spagat, diese gemischten Gefühle von Anziehung und Fremdheit in ein lebensnahes Gesamtbild zu bringen, ohne dabei als posthume Nestbeschmutzerin zu erscheinen, ist Brennan-Jobs gelungen. Er zieht sich durch das gesamte und unbedingt lesenswerte Buch.“
Hamburger Abendblatt„Das Buch liefert keine Abrechnung, es eist ein selbstbewusstes Heraustreten aus dem Schatten des übermächtigen Vaters.“
Business Vogue„Lisa Brennan-Jobs selbst wollte gegen den übergroßen Schatten eines berühmten Vaters anschreiben. Ihr ist ein wundervolles Buch über Kindheit, Vertrauen, Annäherung und Abgrenzung gelungen, das nicht nur für Steve Jobs-Fans neue Erkenntnisse birgt. Es ist ein Buch für allein erziehende Mütter, verlassene Kinder und abwesende Väter. Und für Steve-Jobs- und Silicon-Valley-Fans auch.“
t-online.de„Herzzerreißend und komisch – eine Kindheit, die man so nie erfinden könnte.“
kunstkulturlifestyle.com„›Beifang‹ ist eine sehr gelungene, authentische und mitreißende Biographie.“
aufgeblaettert.de„Das Buch ist mehr als die Erinnerungen einer Tochter eines sehr berühmten und erfolgreichen Manns. Es ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Vater-Tochter-Beziehung und die einer ziemlich starken jungen Frau und ihrer starken Mutter.“
Presse Wien (A)„›Beifang‹ kann sicher dabei helfen, das Mysterium Steve Jobs etwas auszuleuchten. Doch ist das Buch auch eine universelle Erzählung von einem Mädchen, das ohne einen zuverlässigen Vater aufgewachsen ist - der in diesem einen Fall eben ein Milliardär war.“
Süddeutsche Zeitung



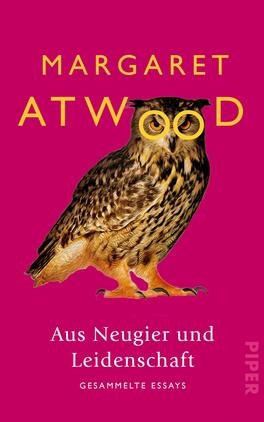

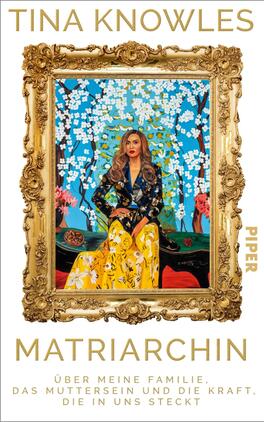
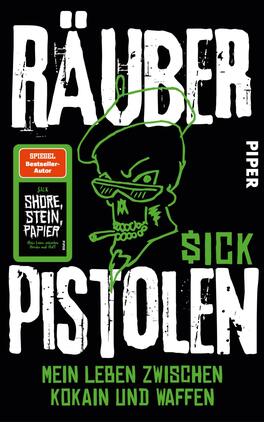
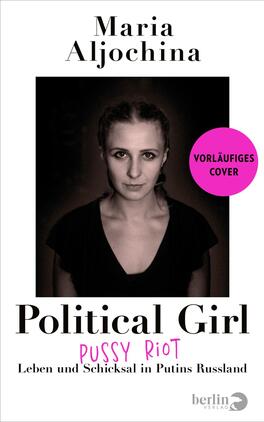
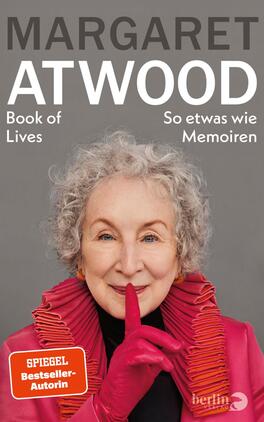

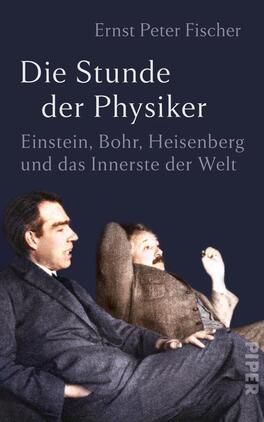




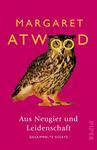


Die erste Bewertung schreiben