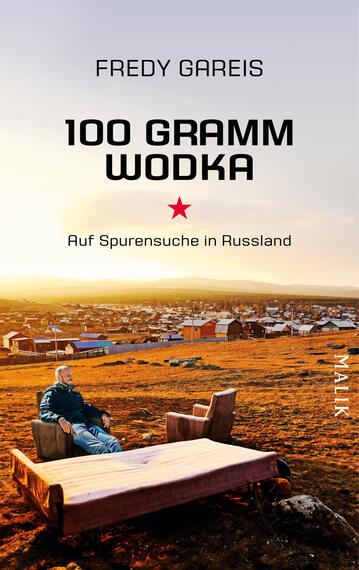
100 Gramm Wodka - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Hinreißender, feuchtfröhlicher und bisweilen halsbrecherischer Roadtrip durch ein Land voller Widersprüche.“
ÖKO-TEST MagazinBeschreibung
Was hat es mit dem geheimnisvollen Himbeersee auf sich, an dem seine Großmutter unter Stalin zehn Jahre in einem Straflager war? Wie kam es, dass seine Mutter den Geburtsort „Soda-Kombinat“ im Pass trägt? Fredy Gareis wächst als Kind von Russlanddeutschen auf – mit vielen offenen Fragen, denn über das Schicksal seiner Familie wurde zu Hause nie gesprochen. Und so macht er sich mit 39 Jahren selbst auf, das Riesenland im Osten zu erkunden. Vier Monate fährt er mit einem alten Militärjeep quer durch Russland, wandelt auf den Spuren seiner Familie, setzt das Puzzle seiner Kindheit zusammen,…
Was hat es mit dem geheimnisvollen Himbeersee auf sich, an dem seine Großmutter unter Stalin zehn Jahre in einem Straflager war? Wie kam es, dass seine Mutter den Geburtsort „Soda-Kombinat“ im Pass trägt? Fredy Gareis wächst als Kind von Russlanddeutschen auf – mit vielen offenen Fragen, denn über das Schicksal seiner Familie wurde zu Hause nie gesprochen. Und so macht er sich mit 39 Jahren selbst auf, das Riesenland im Osten zu erkunden. Vier Monate fährt er mit einem alten Militärjeep quer durch Russland, wandelt auf den Spuren seiner Familie, setzt das Puzzle seiner Kindheit zusammen, übersteht Wodkaexzesse, macht hinreißende Zufallsbekanntschaften und versucht nebenbei zu ergründen, wie die Menschen im Land von Putin wirklich leben.
Über Fredy Gareis
Aus „100 Gramm Wodka“
Ein Ende, ein Anfang
Mutter weint.
Wir stehen auf dem Parkplatz vor unserem Hochhaus; ihr Schluchzen ist das einzige Geräusch zwischen den Betonmauern der Sozialbauten. Es ist Samstagmorgen, fünf Uhr. Die Nacht verabschiedet sich, und der Tag bricht an.
„Fahr du, bitte“, sagt sie mit matter Stimme und drückt mir den Schlüssel in die Hand.
Ich starte den Motor und lenke den Wagen durch die Häuserreihen zum Autobahnanschluss Rüsselsheim-Mitte, fahre auf die Rampe und gebe Gas. „Nicht so schnell“, mahnt mich meine Mutter. Sie hat kein Interesse, allzu rasch ans Ziel zu [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Der Autor schafft es mit seinen Worten mich als Leser mitzunehmen auf eine Reise in dieses Land. (...) Ein ganz persönlicher Reisebericht über Russland – fesselnd zu lesen.“
lovelybooks.de„Die wichtigste Erfahrung seiner Reise ist für ihn daher, nicht nur Geschichten darüber zu hören, woher seine Familie kommt, sondern seine eigenen Erlebnisse zu ergänzen. Auch damit die Geschichten der Verwandten nicht mit ihnen sterben.“
dradiowissen.de„Das Buch kratzt an der Seele. Es nähert sich Russland mit Entdeckerfreude, die aber nicht unbefangen ist.“
Süddeutsche Zeitung„wunderbares Buch“
HALLO München„Der fesselnde Bericht einer persönlichen Spurensuche, voller abenteuerlicher Erlebnisse, skurriler Begegnungen und berührender Momente.“
Globetrotter„Er zeigt dem Leser Russland mit all seinen Facetten, mit pulsierenden Großstädten und öden Steppen, mit herzlichen Menschen, aber auch mit einem misstrauischen Staat, der seine Ohren scheinbar überall hat.“
Gießener Allgemeine„Ein hinreißendes Buch!“
Dresdner Neueste Nachrichten„fesselnder Reisebericht“
Clever Reisen„Der bemerkenswerte Reisebericht wurde heuer mit dem ITB Award ausgezeichnet.“
(A) Die Presse„Hinreißender, feuchtfröhlicher und bisweilen halsbrecherischer Roadtrip durch ein Land voller Widersprüche.“
ÖKO-TEST Magazin1 Ein Ende, ein Anfang
2 Санкт-Петербург – Sankt Petersburg: Der Westen im Osten
Die fremde Seele
Literaten und Despoten
Wahlverwandtschaften
3 Москвa – Moskau: Der Kopf Russlands
Fliegende Kommission XXVII, Sonderzug
Kultiviertes Trinken
UAZ-469 meldet sich zum Dienst
4 Чувашия – Tschuwaschien: Blut, Schweiß und Wodka
Lachen ist eine ernste Sache
Russische Fische lieben Pfannkuchen
Die Banja am Ende der Straße
Eine Hochzeit auf dem Land
Stille Tage in Tschuwaschien
5 Волга – Wolga: Das blaue Band
Einbeiniger Superheld
Die L-Protokolle
Ganz normalna
6 Урал – Ural: Von Kontinent zu Kontinent
Mein Vater, der Fremde
Das russische Anderswo
7 Азово – Asowo: Die russische Seele braucht Weite
Die Ohrfeige
Ein Leben zwischen Hammer und Amboss
8 Алтай – Altai: Das magische Licht der Steppe
Katjuschas Gruß
Über die Automatisierung von Fabrikprozessen
Babuschkas Himbeersee
9 Қазақстан – Kasachstan: Ursprünge
Durch die Steppe
Eine Rückkehr, eine Prophezeiung
10 Байкaл – Baikalsee: Goldener Herbst am großen See
Die Nacht der Gopniks
Tatjanas traurige Augen
Wer keine Pläne hat, ist ein freier Mann
11 Якутия – Jakutien: Die Kälte des Fernen Ostens
Wo Milch geschnitten wird
Auf der Straße der Knochen
Die zweite Prophezeiung
12 Picknick mit einer Toten
Soundtrack zum Buch
Dank
Literaturverzeichnis











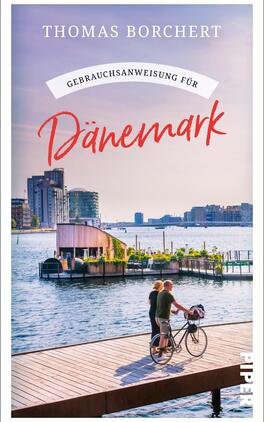

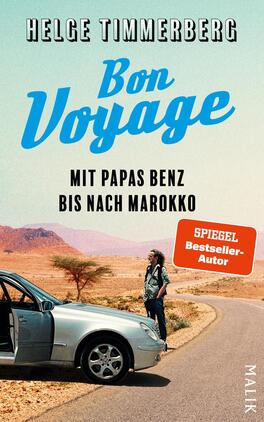




Die erste Bewertung schreiben