Wie erzählt man eine Geschichte, die vielleicht gar nicht erzählt werden will, und deren Hüterinnen sich mit dem Ende einer Dynastie und Ära konfrontiert sehen?
„Die Revolution war jetzt 27 Jahre her, und wir lebten immer noch in einer Endlosschleife aus Wohin gehen wir, was tun wir?"
Shirins Vater war im Cabrio durch Teheran gefahren, blaue Ledersitze, die Herald Tribune auf dem Schoß. Die Valiats gehörten zu den wichtigsten Familien in Iran, ihr Reichtum war unermesslich. Jetzt, im amerikanischen Exil, musste sich Shirin vor einem Gericht verantworten: versuchte Prostitution. Lachhaft, meint sie.
Das sieht ihre Nichte Bita ganz anders. Die pflichtbewusste Bita. Doch eines steht fest: Für beide wird es allmählich Zeit, sich ihrer verdrängten Familiengeschichte zu stellen.
Reisen in den Iran - ist das möglich?
Unsere Autor:innen Nadine Pungs und Stephan Orth haben den Iran bereist und sind überzeugt: Wer sich auf das Land und die Menschen einlässt und die gängigen Klischees über Bord wirft, wird mit eindrucksvollen Erfahrungen belohnt.
„Eine Reise nach Iran beginnt meist in der Hauptstadt Teheran, der pulsierenden Metropole am Fuße des Elburs-Gebirges. Die Stadt ist jung, agil, aufgeschlossen und ziemlich westlich geprägt. Vom Islam merkt man hier auf den ersten Blick nicht viel ...“
Sich trauen
Der Iran gilt seit einer Aussage des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush als „Achse des Bösen“, und seitdem ein orangefarbener Präsidentendarsteller im Weißen Haus mehr twittert als denkt, ist der Iran mittlerweile wieder auf das Niveau eines „Schurkenstaats“ herabgestiegen. Dieser ganze propagandistische Dreck hat sich über die Jahre in unser (westliches) Hirn festgezeckt. Auch in meins. Ergo ist es fast unmöglich, ohne Klischees in den Mittleren Osten aufzubrechen.
Nichtsdestotrotz sollte man es dennoch wagen; man könnte überrascht werden. Die Realität sieht nämlich anders aus. Ich rate dir deshalb: Hör nicht auf Ansichten von Leuten, die nichts wissen! Nein, trau dich! Geh hin!
In einer Welt, in der Meinungen mehr zählen als Fakten, ist es unerlässlich, sich selbst auf den Weg zu machen und nachzuschauen!
Sich einfangen lassen
Ein Klischee über den Iran stimmt: die überbordende Gastfreundschaft. Ob eine Einladung zum Chai oder zum Abendessen – die Iraner möchten sich kümmern. Das kann zuweilen anstrengend sein, zumeist ist es aber einfach sehr liebenswürdig und bewundernswert. Sofern es sich nicht um Ta’arof handelt – also nur Höflichkeitsgeste ist – solltest du Einladungen annehmen. Lass dich einfangen! Du wirst am Ende immer reicher sein als vorher. Denn auf diese Weise lernst du Land und Leute tatsächlich und abseits westlicher Vorurteile kennen. Und die berühmte persische Freundlichkeit wird dich ganz sicher berühren. Die meisten Iraner sind nämlich unglaublich großmütige Menschen. Von wegen „Schurkenstaat“. Mir ist auf meinen Reisen nicht ein einziger „Schurke“ begegnet, sondern zumeist höfliche, vorurteilsfreie und fürsorgliche Frauen und Männer, die ihre Herzen bedingunglsos verschenkten.
P.S.: Mach dich bereit für viele, viele Selfies mit vielen, vielen freudigen Iranern.
Ramadan
Wenn du in den Iran reist, dann checke vorher unbedingt die Daten. An Ramadan schenkt ein Trip durch die Islamische Republik nicht immer Frohsinn. Im Fastenmonat präsentiert sich das Regime nämlich totalitärer als sonst. Wer an Ramadan raucht oder isst und sich von der Polizei erwischen lässt, dem drohen Peitschenhiebe. Geraucht und gegessen wird trotzdem. Sogar in den Hinterzimmern der Moscheen.
Als Reisender hat man zwar den Touri-Bonus, und außer einer Verwarnung dürfte nicht viel passieren, doch ich würde es nicht darauf ankommen lassen. Zudem verkaufen die Imbissbuden und Restaurants tagsüber kein frisch gekochtes Essen. Und in der Öffentlichkeit ist selbst das Nippen an einer Wasserflasche verboten. Das kann für schlechte Laune sorgen.
Auf der anderen Seite könnte eine Reise während des Ramadan dennoch für unvergesslich schöne Erlebnisse sorgen. Nämlich dann, wenn abends die Familien zusammenkommen und das Leben feiern. Und wenn noch köstlicheres Essen aufgetischt wird als sowieso schon. Definitiv eine besondere Zeit.
Lügen
Lüg! Nenne niemals den Namen deines Couchsurfing-Gastgebers, verrate nicht, wer dir den Alkohol ausgegeben hat und halte dich mit politischen Äußerungen in der Öffentlichkeit zurück.
Die Lüge ist unausweichlich, wenn das Leben davon abhängt. Nicht dein Leben. Du kannst den Iran wieder verlassen. Doch achtzig Millionen Menschen können das nicht so leicht. Du trägst Verantwortung für das, was du über deine iranischen Bekanntschaften (z.B. in sozialen Netzwerken) preisgibst! Die Situation entscheidet über die Wahrheit. Und bedenke: Mit deiner Lüge schützt du deine Gastgeber. Also lüg!
Gastfreundlich und großherzig seien die Iraner, so berichten Wiederkömmlinge. Und – welch Überraschung – die Frauen hier seien sogar selbstbewusst und gebildet. Da staunt so mancher Westler. Verbindet er mit dem Iran doch eher Atomraketen. Persien jedoch, das zaubert eine Verklärung ins Gesicht. Da fliegen nicht Raketen, sondern Teppiche. In Persien berauschen die Gärten, die Mosaike, die Basare.
Aber ist diese Darstellung nicht auch nur Klischee? Die netten Perser, die Herzlichkeit? Gibt es nichts zwischen Morgenland-Nostalgie und finsterer Mullah-Hegemonie?

© Naqshe Jahan, Isfahan, Iran
Hejab
„Als Frau? Alleine?“ Das war die häufigste Frage, die mir vor meinen Reisen in den Iran gestellt wurde. Und meine Antwort lautete stets: „Ja, klar, warum nicht?“
Grundsätzlich kannst du als Frau überall auf der Welt allein reisen. Ich verstehe die Hysterie darum nicht. Wir Frauen haben es sogar oftmals leichter, denn wir werden eingeladen, beschenkt und uns wird die Tasche getragen. Also trau dich (siehe Punkt 1)! Was eine Reise in den Iran allerdings für Frauen schwierig macht, ist die Kleider(ver)ordnung; der stattliche Zwang zum Hejab. Also Kopftuch und ein langes Hemd, das die weiblichen Kurven verwischt. Auch bei 40 Grad Hitze. Sei dir darüber bewusst; sobald du das Haus verlässt, musst du regimekonform eingesackt sein.
Für den Anfang und gegen im Wind umherflatternde Schleier helfen übrigens Haarklammern, mit denen man das Tuch am Kopf festpinnen kann. Doch trotz all der modischen Tricks und Raffinessen - die Verschleierung ist und bleibt Unterdrückung!
Randnotiz: Seit Ende 2017 nehmen überall im Land mutige Frauen ihre Kopftücher ab und schwenken es wie eine Friedensfahne. Auf der Facebookseite My Stealthy Freedom findest du weitere Infos.
Kleid und Kajal
Dass sich frau in der Öffentlichkeit verhängen muss, bedeutet nicht, dass die Verschleierung auch privat Vorschrift wäre. Gewiss, in konservativen Familien sollten alle Frauen verschleiert sein, sobald ein nicht verwandter männlicher Zeitgenosse zugegen ist. Aber ansonsten kann es nicht schaden, Kleid und Kajal im Rucksack dabei zu haben. Denn Partys und Hochzeiten werden recht chic, recht ausgelassen und recht häufig gefeiert. Und eingeladen wird man ohnehin (siehe Punkt 2).
Als ich das erste Mal im Iran gereist bin, hatte ich aus Platzgründen außer Hejabs nichts im Ranzen; und so war ich auf den persischen Hauspartys unerträglich underdressed. Denn Iranerinnen sind Meisterinnen im Stylen. Und wer sich nicht wie Fräulein Prusseliese fühlen möchte, dem sei neben den Hejabs unbedingt hübsche Ausgehkleidung empfohlen.
Perser und Araber
Vergleiche niemals Iraner mit Arabern. Das ist schon kein Fettnäpfchen mehr, sondern ein ganzer Fettsee. Denn Iraner sind keine Araber, sie sind Perser. Sie sprechen Farsi, nicht Arabisch (außer in Randgebieten). Und sie sind stolz. Sehr stolz.
Faramarz Aslani hören
Er ist der iranische Bob Dylan – der Sänger, Gitarrist und Komponist Faramarz Aslani. Jeder, wirklich jeder Iraner kennt ihn. Seine Lieder werden seit den Siebzigerjahren gespielt. Er singt von Liebe und von den großen persischen Dichtern, die ihn inspirierten.
Hier drei besonders schöne und bekannte Songs:
Age ye Rooz
To
Ahooye Vahshi
Hafis lesen
Hafis ist nicht nur irgendein Dichter, Hafis ist Nationalheld. Sogar Goethe verehrte den im 14. Jahrhundert geborenen Poeten. Und in jedem iranischen Haushalt findet sich mindestens ein Bändchen des legendären Lyrikers, der Wein, Weib und Gesang gleichermaßen liebte. Deshalb: lies Hafis:
Droht der Weltschmerz mit steter Erweiterung,
Bleibt kein Mittel als Wein zur Erheiterung.
Das Herz öffnen
Hier schließt sich der Kreis und schlägt den Bogen zum allerersten Tipp. Und wahrscheinlich kommt jetzt der wichtigste Ratschlag, denn ohne geht es nicht: Öffne dein Herz! That’s it.
Der Iran fordert, der Iran bestürzt, aber der Iran beschenkt auch. Hab also den Mut und schau hin! Sei bereit, Klischees über Bord zu werfen! Freu dich über die Gastfreundschaft und über jedes ehrliche „Welcome to Iran“, das dir zugerufen wird! Lass dich einfangen, trink Chai, trink (verbotenen) Wein, iss Safraneis, tanz auf Dächern, spiel Backgammon, geh in die Moschee, sprich mit den Menschen und sei neugierig! Dann kann nichts schiefgehen und du trägst ein randvolles Herz zurück nach Hause.
Noch mehr Tipps von Nadine Pungs und Infos zu ihrer Iran Rundreise gibt es in ihrem Buch „Das verlorene Kopftuch. Wie der Iran mein Herz berührte.“
Mai 2018
Ali kennen
Lerne unbedingt zwei Fußballspielernamen: Ali Daei und Mehdi Mahdavikia. Wenn du die nennst, gewinnst du auch ohne weitere Persischkenntnisse problemlos neue Freunde.
Nein sagen
Es ist sehr wichtig, die Taarof-Höflichkeitsprotokolle zu verstehen. In vielen Fällen gilt die Regel: Erst wenn jemand mehr als dreimal etwas anbietet, sollte man es auch tatsächlich annehmen. Selbst Taxifahrer und Teppichhändler bieten ihre Dienste manchmal gratis an – doch wer so ein Geschenk ohne Zögern annimmt, begeht einen groben Fauxpas.
Zebras misstrauen
Glauben Sie in einer beliebigen iranischen Großstadt niemals, dass Zebrastreifen Autofahrer zum Bremsen animieren. Iraner sind halsbrecherische Autofahrer, und Zebrastreifen sind Fallen.
Couchsurfing nutzen
Mehr als 13.000 Mitglieder verzeichnet die Internetseite couchsurfing.org bereits im Iran. Die Menschen sind unglaublich gastfreundlich und sehr interessiert an Berichten aus dem Alltag in Europa. Allerdings schläft man fast nie auf einer Couch – meistens dient ein Perserteppich als Schlafunterlage.
Viber klarmachen
Lade dir die Kommunikations-App „Viber“ herunter. Fast jeder junge Iraner nutzt den Dienst, WhatsApp dagegen ist blockiert.
Tee trinken
Es ist kaum möglich, 15 Minuten auf einem beliebigen Basar zu verbringen, ohne mindestens einmal zum Tee eingeladen zu werden. Am besten trinken wie die Einheimischen: Das Stück Zucker kommt in den Mund, dann wird das Heißgetränk daran vorbeigespült.
Cash bunkern
Bislang gibt es im Iran keine Geldautomaten, die europäische Karten akzeptieren. Man muss alles benötigte Geld in bar mitnehmen und vor Ort in Wechselstuben eintauschen.
Heiraten
Wenn ein Mann mit einer Frau reist, darf er mit ihr kein Hotelzimmer teilen, wenn sie nicht verheiratet sind. Von Ausländern wird aber zumindest in den Touristenorten wie Isfahan, Shiraz oder Yazd meist kein Beweisdokument verlangt. Es bringt also gewöhnlich keinen Ärger, wenn man sich als Ehepaar ausgibt.
Reisetipps Einheimischer ignorieren
Fast jeder Iraner schwärmt von der Insel Kish und von den grünen Wäldern im Norden Irans. Doch für viele europäische Gäste ist beides eher eine Enttäuschung: die Insel wegen der vielen Hotelhochhäuser und Shoppingcenter (wie Dubai vor 20 Jahren). Und die Wälder, weil sie auch nicht spektakulärer sind als der Teutoburger Wald. Lieber stattdessen in die Wüste fahren!
Khayyam lesen
Gotteslästerung und Saufpoesie: Die Verse, die der persische Universalgelehrte Omar Khayyam im 11. und 12. Jahrhundert schrieb, haben bis heute nichts von ihrer subversiven Frechheit eingebüßt. Unbedingt vor der Abreise lesen! Zum Beispiel dieses Gedicht:
Dass einst ich trinken würde zu meiner Zeit,
Hat Gott gewusst seit aller Ewigkeit.
Drum reich mir nur den Trunk, denn tränk ich nicht,
Wo bliebe da seine Allwissenheit?
Im März 2015
Stephan Orth
Da es im Iran keine offiziellen Discos oder Bars gibt, feiern die Menschen ihre Partys im Wohnzimmer. Stühle und Teppiche werden beiseitegeschoben, die Vorhänge zugezogen, und die Musik laut aufgedreht. Der Tisch biegt sich unter süßen Küchlein, Pizzen, Salat, ein paar Schüsseln Joghurt, Nüssen, Chee.Toz (Ähnlichkeiten mit den amerikanischen Cheetos-Käsecrackern sind rein zufällig), Auberginenmousse, Fladenbrot, und Vater holt den Rosinenschnaps aus dem Einbauschrank. Nicht nur Nouruz, Geburtstage oder das Sonnenwendfest Yalda werden zelebriert. Für ausgelassene Feten braucht es keinen Anlass. Perser feiern die Feste, wie sie fallen oder nicht fallen. Hauptsache, sie feiern. Frauen tragen Eyeliner und Miniröcke, die Männer klemmen die Smartphones an die Stereoanlage. Persische und westliche Popmusik dröhnt aus den Boxen, und Finger schnipsen. Omas und Opas, Jungs und Mädels – alles tanzt. Während sich deutsche Eltern abmühen, ihre Sprösslinge mit Sätzen wie „Ab ins Bett!“ zum Einschlafen zu zwingen, schwofen iranische Kinder einfach so lange, bis sie vor Müdigkeit umkippen. Matratzen gibt es sowieso genug.
Wer also jemals zu einer persischen Hausparty eingeladen ist und nicht tanzen mag (was sich per se ausschließt), verlässt den Raum, denn andernfalls zerren steppende Iraner ihn auf den wohnzimmerlichen Dancefloor. Weigert man sich immer noch, so kann man gewiss sein, dass die gesamte Gesellschaft in Sprechchören den Namen des Spielverderbers ruft und dabei im Takt klatschen wird. Ein Graus für deutsche Tanzmuffel, doch besser, man fügt sich dem Schicksal und lernt von den Persern. Männer tanzen mit Frauen, Frauen tanzen mit Männern. Berührungen zwischen Unverheirateten. Eine Lehrstunde in Lebenslust.
Aus »Das verlorene Kopftuch« von Nadine Pungs
Behauptet zumindest eine Plakette an seiner Außenmauer. Die Ausstellungsstücke sind tatsächlich sensationell. Wer weiß schon, dass die Perser den ersten Trickfilm der Welt gedreht haben! „Gedreht“ im wahrsten Sinn des Wortes. Es handelt sich um einen runden Tonkelch, auf dem ein Steinbock zu sehen ist, der zu den Ästen eines Baumes hochspringt. Aus fünf Einzelbildern besteht die Szene, wer das Gefäß schnell genug dreht, kann die Bewegung wahrnehmen wie bei einem Daumenkino.
Bei den Oscars 2300 vor Christus hätte „Bock frisst Blätter“ in allen Kategorien abgeräumt, Drehbuch, Regie, Hauptdarsteller und Spezialeffekte sowieso, außerdem Soundtrack (Ton reibt auf Sandboden) und bester Nebendarsteller (der Baum). Leider gab es die Oscars damals noch nicht. Das kulturelle Geschehen in Deutschland zur gleichen Zeit? Ein paar langhaarige Zausel, die abends in der Höhle von der Jagd erzählten. Die Kulturszene in den USA damals? Nun, Sie verstehen schon.«
Aus „Couchsurfing im Iran“ von Stephan Orth
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.





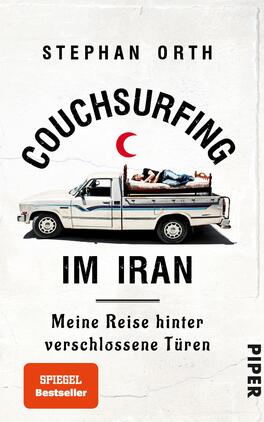
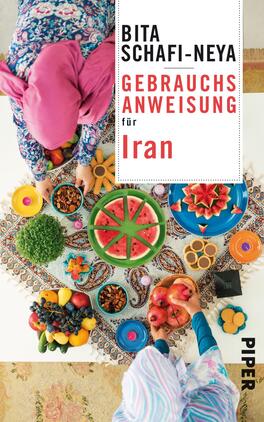

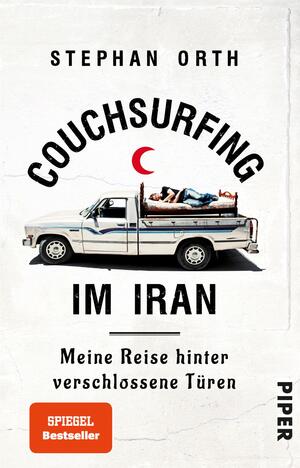



Gotteslästerung und Saufpoesie? Da sind Sie in einem Fettnäpfchen getretten!