
Der letzte Zeuge
Mit einem Vorwort von Ralph Giordano
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Lesenswert, weil es eben eine typisch deutsche Geschichte erzählt.
Lübecker NachrichtenBeschreibung
„Misch – Sie werden natürlich noch gebraucht.“ Dieser gespenstische Befehl ergeht am 22. April 1945 im „Führerbunker“ an Rochus Misch, den Leibwächter und Telefonisten Adolf Hitlers. Kaum ein anderer hat die Kriegsjahre in ebenso ungeheuerlicher wie ungewöhnlicher Nähe Hitlers zugebracht. Nun erzählt der „letzte Zeuge“ seine Geschichte, mit der beklemmenden Aufrichtigkeit eines Mannes, der erkennen muss, dass er damals sein Tun für richtig hielt. – „Wenn ich Rochus Misch begegnen sollte – ich würde ihm ohne Zögern die Hand geben“ (Ralph Giordano im Vorwort).
Über Rochus Misch
Aus „Der letzte Zeuge“
I.
EINLEITUNG
Ich hatte niemals vor, meine Biografie zu veröffentlichen. Unzählige Interviews habe ich im Verlauf meines Lebens Autoren, Zeitungsreportern, Historikern und Fernsehteams aus aller Welt, eher wenigen aus Deutschland, gegeben. Es ist alles gesagt – dachte ich. Doch die Tatsache, dass die Anfragen, die mich per Post und Telefon erreichen, in den letzten Jahren zu- statt abnehmen, hat mich eines Besseren belehrt. Die Zuschriften sind zum allergrößten Teil freundlich und interessiert, und sie stammen von jungen, oftmals sehr jungen Menschen. Mich plagt ein [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
Rochus Misch verherrlicht nichts, kritisiert nichts und rechtfertigt nichts, auch nicht sich selber. Er hat einen scharfen Blick für Details, die er auch nach all den Jahren glaubhaft schildert ... Die Faszination des Buches liegt in Misch selbst. Er verkörpert den typischen Deutschen seiner Zeit wohl sehr genau: Kein Fanatiker war er, kein glühender Nazi. Unpolitisch und eher aufs eigene Durchkommen bedacht.
Göttinger TageblattLesenswert, weil es eben eine typisch deutsche Geschichte erzählt.
Lübecker NachrichtenINHALT
I.
Einleitung
Vorwort: Ralph Giordano
„Misch – Sie werden natürlich noch gebraucht!“
II.
Der Waisenjunge vom Dorf
Olympia 1936
„Auserwählt“
Kriegsbeginn
Hitler sucht einen Kurier
Im Begleitkommando
Der „Chef“
Wilhelmstraße 77
Die Alten
Alltag in der Reichskanzlei
Mein Reich – die Telefonzentrale
Der Berghof
Dienst wie Urlaub
Eva
Molotows Bunker
Heß fliegt nicht
„Amerika“
Ein Irrflug und seine Folgen
Die „Wolfsschanze“
Modelle und Miniaturbauten
Magenschmerzen
„Werwolf“
Stalingrad
Flitterwochen
Die Ostfront auf dem Weg nach Westen
Hitlers Schatzkammer
Onkel Paul im KZ
Handschlag mit Mussolini
Heilig, Abend und zwei Rendezvous
Schürzenjäger
Vermählungen und Verrat
20. Juli 1944
Ausgezeichnete Generäle
Tod und Zerstörung
Bunkertelefonist
Der „Führerbunker“
Rauf und Runter
Bunkerleben
20. April 1945
21. April 1945
22. April 1945
23. April 1945
24. April 1945
25. April 1945
26. April 1945
27. April 1945
28. April 1945
29. April 1945
30. April 1945
1. Mai 1945
Der Ausbruch
Im Tunnel
Gefangenschaft
Folter
Sieben Wochen Berlin
Neun Jahre Gulag
Rückkehr und Neuanfang
John F. Kennedy, Prinz Philip und Rochus III.
Epilog: Er blieb da, an seinem Platz, bis nach dem Untergang
ANHANG
Anmerkungen
Kurzbiografien
Literatur
Abbildungen
Danksagung




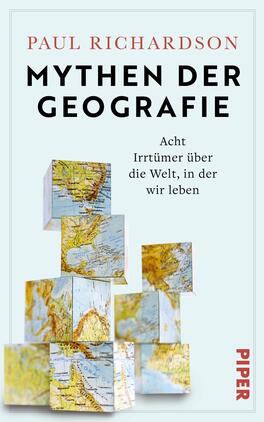
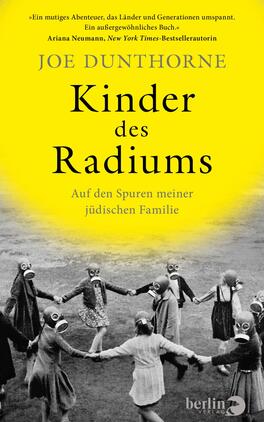









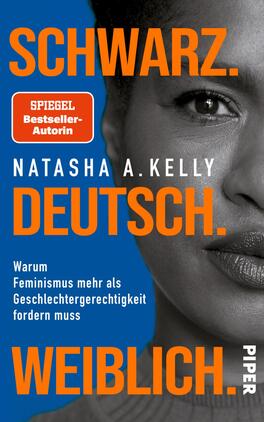



Die erste Bewertung schreiben