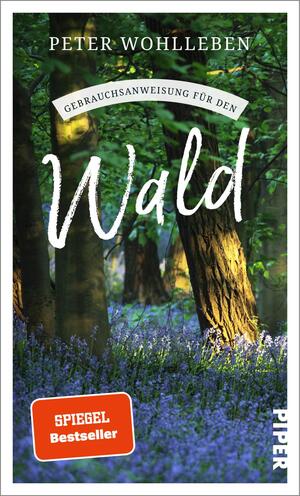Waldbücher
Raus in die Natur: Gehen Sie mit unseren Autoren auf Entdeckungsreise in unsere Wälder und spüren Sie der Faszination von Bäumen nach.
Warum uns der Kontakt zur Natur hilft
„Sind wir entspannt und ist unser Kopf frei, können wir uns viel klarer darüber werden, welche Dinge für uns wichtig sind und worüber wir uns mit anderen Menschen unterhalten möchten. Es macht einen Unterschied, ob wir gestresst sind und kommunizieren oder ob wir körperlich und geistig im Gleichgewicht sind, wenn wir mit anderen Informationen austauschen. Wir alle bewegen uns immer stärker in einer menschgemachten Umgebung wie der Stadt, und dies hat natürlich Einfluss auf uns als Lebewesen, aber auch auf alle anderen, nicht menschlichen Stadtbewohner.
So bestätigen Studien, dass vor allem Menschen im urbanen Raum permanentem Stress ausgesetzt sind und dass dieser Stress nachlässt, sobald wir uns in naturnahen Lebensräumen wie einem Wald, im Gebirge oder an der See aufhalten.
Ein paar Stunden im Wald nehmen sofort einen positiven Einfluss auf unser Immun- und Hormonsystem. Die Japaner haben dafür sogar ein eigenes Wort: Shinrin Yoku bedeutet im Deutschen sinngemäß so viel wie „ein Bad in der Atmosphäre des Waldes nehmen“ oder, auf ein Wort reduziert, „Waldbaden“. Diese Form der Gesundheitsvorsorge ist unter Japanern allgemein anerkannt und führt zu einem regelrechten Waldtourismus.
In der Natur kommen wir zur Ruhe, hier verlangsamen sich unsere Gedanken, und wir entspannen. Eine gesunde Ernährung, Bewegung an der frischen Luft und ausreichend Entspannung sind aus meiner Sicht nicht nur der Schlüssel zu einem zufriedenen Leben – diese Dinge helfen Ihnen auch bei Ihrer Kommunikation.” Madlen Ziege aus „Kein Schweigen im Walde”
Den Wald verstehen und schützen
Einmalige Einblicke eines Försters in den Zustand von Deutschlands Wäldern
Einzigartig und berührend: Wie ein Mann bei den Tieren des Waldes (über-)lebte
Peter Wohlleben ist Deutschlands berühmtester Förster
„Eine Liebeserklärung an die Natur“ Hörzu
Von der Leichtigkeit des Gehens
„Sehr erhellend und unterhaltsam!“ Peter Wohlleben
Mikroabenteuer vor der Haustür
Gewinner des Banff Mountain Book Award 2022 in der Kategorie Adventure Travel
Unsere Blogs zum Thema