
Historische Romane aus dem Mittelalter
Der Glanz des Mittelalters, die Gewalt der Kreuzzüge, die Macht der Liebe
Eine Zeitreise ins Mittelalter
Möchten Sie eine Reise in das Mittelalter unternehmen und neue Welten entdecken? Dann bieten unsere historische Roman die perfekte Kulisse! Lassen Sie sich entführen in eine lange vergangene Zeit und erleben Sie Geschichten, die unter die Haut gehen.
„Unverbrauchte Themen, originelle Figuren, präzise Recherche: Juliane Stadlers Roman ›König der Turniere‹ überzeugt auf ganzer Linie!“ Daniel Wolf
Zu dem historischen Hintergründen des Romans
Der englische Historiker David Crouch beschreibt das Turnier des 12. Jahrhunderts als eine Art „American Football vom Pferderücken mit spitzen Stöcken und ohne Schiedsrichter". Das trifft den Kern dieses brutalen und gefährlichen Kampfsports ziemlich genau. Anders als Hollywood uns glauben machen will, steht zu dieser Zeit nicht der sogenannte Tjost, das Lanzenstechen zweier Ritter, im Mittelpunkt des Geschehens.
Eine Verlagerung dorthin findet erst später statt. Im Hochmittelalter ist der Tjost lediglich ein Teil der oft mehrtägigen Turnierveranstaltungen, die auch Geschicklichkeitswettbewerbe und Schaureiten umfassen. Er dient dem Kräftemessen meist jüngerer, wenig bekannter Ritter, die bei dieser zuschauerfreundlichen Art des Wettstreits etwas mehr Aufmerksamkeit für sich erhoffen.
Als einer der strahlenden Turnierhelden des ausgehenden 12. Jahrhunderts gilt Henri Plantagênet, Erbe des englischen Throns und älterer Bruder des späteren Richard Löwenherz. Er wird weithin als Idol verehrt." Juliane Stadler, Autorin und Historikerin
„(Ein) historischer Roman der Extraklasse“ Daniel Wolf
Die Geschichte von Hildegard von Bingen
Historischer Roman über ein der wichtigsten heilkundigen Frauen im Mittelalter
Der große historische Roman der italienischen Renaissance
Die historischen Romane von Maggie O'Farrell sind vielfach ausgezeichnet worden und handeln von real existierenden Persönlichkeiten. In ihrem aktuellen Geschichtsepos widmet sie sich dem Haus der Medici und entführt uns ins Florenz der Renaissance. Durch ihre Geschichten lernen wir nicht nur mehr über das Leben im mittelalterlichen Italien, sonder auch über die Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben. Solche Bücher sind eine hervorragende Quelle für historische Informationen und machen neugierig auf mehr!
Frisuren und Haarschmuck im Mittelalter
Ian Mortimer erklärt für „Zeitreisende“ ins Mittelalter wie die richtige Frisur aussah
Ohne die entsprechende Kopfbedeckung aber ist der mittelalterliche weibliche „Look“ nicht vollständig. Und den Kopfputz kann man nicht ohne die Frisuren beschreiben. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts war der wohl beliebteste adlige Frisurenstil das „Widderhorn“. Das lange Haar (alle adligen Frauen tragen ihr Haar lang) wird in der Mitte geteilt ; jede Seite wird zu einem einzelnen langen Zopf geflochten, und der wird dann zu einer Art Dutt oder Schnecke über dem Ohr aufwickelt und mit einer Haarnadel dort befestigt. Wenn Sie verheiratet sind, tragen Sie einen Reif, eine Haube, einen Hut oder Schleier darüber und befestigen Ihre „Rise“, das Tuch, das unter dem Kinn drapiert wird und den Hals bedeckt, an beiden Seiten. Im Jahr 1300 reicht Ihre Cotte bis zum Boden, und die Ärmel sind so lang, dass sie über die Fingerknöchel fallen. Oft sind von Frauen nur das Gesicht und die Finger zu sehen.
Unter Edward III. ändert sich alles. Auffällig ist vor allem die Technik, die beiden Zöpfe zu nehmen und sie an den Schläfen hoch und wieder hinunter zu führen, sodass sie Säulen aus geflochtenem Haar bilden, die das Gesicht einrahmen. Oft sind diese aufwendig mit goldener Gaze durchwirkt – so trägt Königin Philippa ihr Haar in den 1360ern gern. Ihre Zeitgenossin, die Countess of Warwick, hat ihr Haar ähnlich frisieren lassen; doch statt der steifen goldenen Säulen, die das Gesicht umrahmen, hat sie die beiden geflochtenen Säulen über dem Kopf zusammenlaufen lassen und sie dann mit einem goldenen Netzgitter umhüllt. Das Ergebnis ist ein eindrucksvoller Bogen aus goldenem Haar rund um ihr Gesicht. Diese aufwendigen Frisuren brauchen Stunden.
Die meisten adligen Damen geben sich mit schlichten langen Zöpfen oder einer Variation des Widderhornstils zufrieden; dazu kommen ein Reif oder ein Diadem und eine Rise (wenn sie verheiratet sind). Anne von Böhmen, die Ehefrau Richards II., bevorzugt einen einzigen langen Zopf, der den Rücken hinabfällt.
Unverheiratete Mädchen schmücken sich mit Edelsteinen im Haar – oft mit künstlichen Blumen aus Gold und Juwelen – oder mit pelzbesetzten Kapuzen. Es ist für adlige Damen höchst unüblich, in der Öffentlichkeit mit langem, frei fallendem Haar aufzutreten.
Selbst wenn es einfach unter eine Haube gesteckt wird – es wird bedeckt. Im Jahrhundert zuvor und auch im nächsten ist es durchaus üblich, dass die Frauen ihr Haar offen tragen, doch im 14. Jahrhundert tun zumindest Adlige das nur in der Abgeschiedenheit ihrer Wohngemächer. Langes, offenes Haar gilt allgemein als verführerisch und wird deshalb wie auch nackte Arme und Beine versteckt, um Unschicklichkeit zu vermeiden. Nur zügellose und liederliche Frauen wagen sich mit offenem und unfrisiertem Haar nach draußen.
Warum es sich lohnt, in die mittelalterliche Zeit zu reisen
Historische Romane lassen uns teilhaben am mittelalterlichen Leben und an den Freuden der Menschen in vergangenen Zeiten. Durch die Augen der Figuren erleben wir ihre Sorgen und Nöte, ihre Ängste und Hoffenen. Man lernt aber auch Spannendes über die wichtigsten Ereignisse der damaligen Zeit und entdeckt, wie sich die Gesellschaft in dieser Epoche entwickelt hat.
Ein guter historischer Roman ist aber mehr als eine Geschichte – es ist auch immer ein Spiegel unserer eigenen Gegenwart und kann andere Perspektiven und neue Wege auf unsere Herausforderungen eröffnen.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.

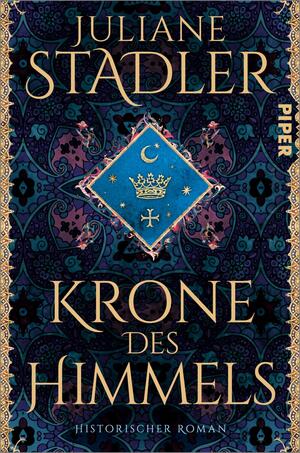
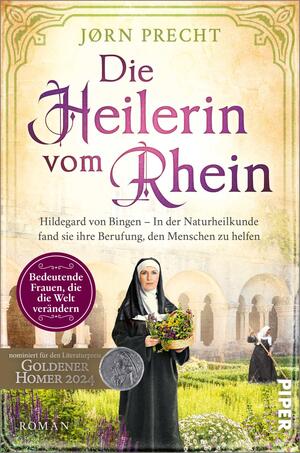
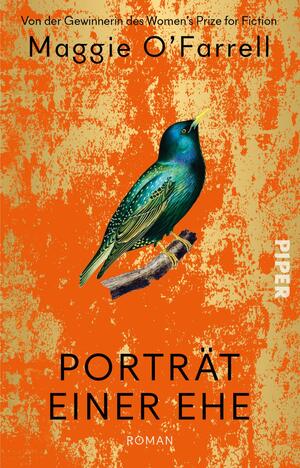
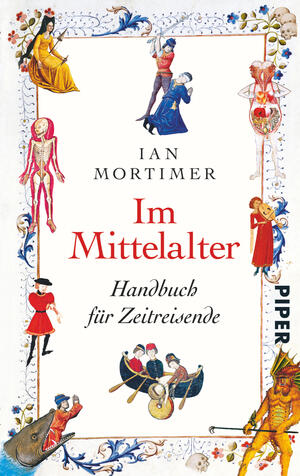
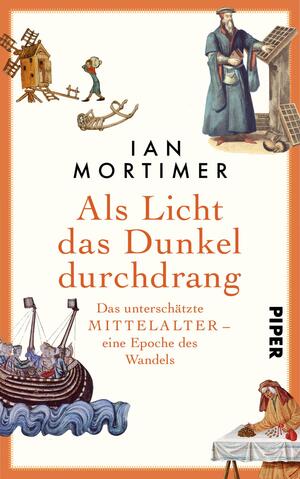
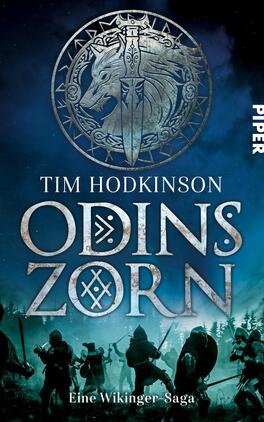
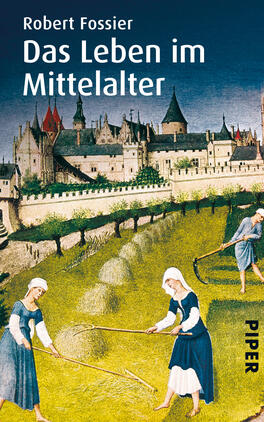
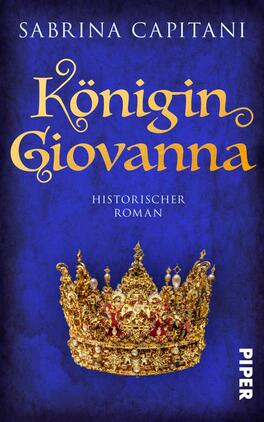
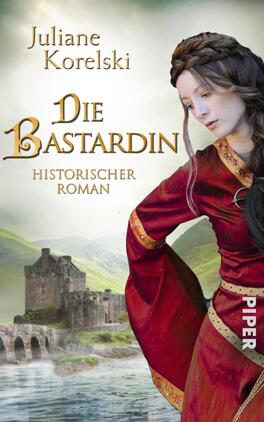
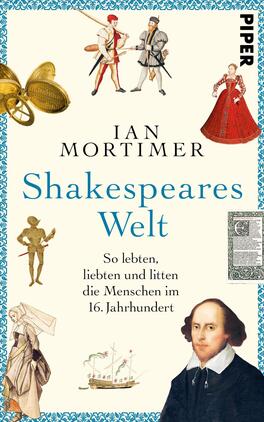
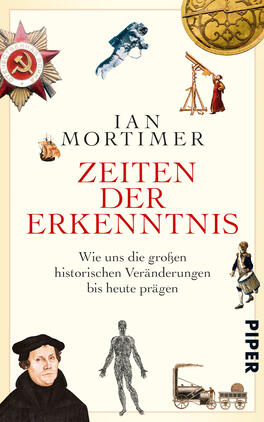
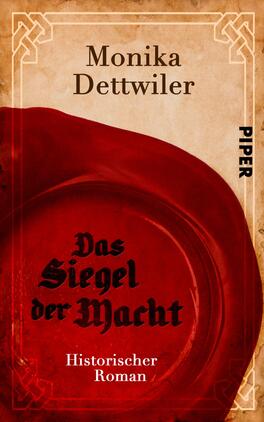
„Krone des Himmels „ dieser großartig geschriebene Roman hat mich bis zum Ende gefesselt. Die Historie ist sehr gut recherchiert. Ich habe jede Seite lesend genossen.
So ein wunderbares Buch! Es liest sich so wunderbar geschmeidig und frisch! Während des Lesens war ich ganz aufgeregt, weil es mich so sehr erfreute es zu lesen. Es ist nicht leicht gut geschriebene historische Bücher von deutschen Autorinnen zu finden. Dieses Buch und Juliane Stadler ist für mich ein wahres Glück! Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Buch! Rebecca Gablé bekommt echte Konkurrenz...