
Streifzüge durch die Nacht - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Weshalb ist die Nacht seit jeher eine Projektionsfläche unserer Ängste und Wünsche, für Märchen und Geschichten? Und warum zieht uns die Dunkelheit so magisch an? Dirk Liesemer wagt sich ein Jahr lang immer wieder in die Einsamkeit der Nacht. Er erkundet das Westhavelland, die dunkelste Region Deutschlands, ebenso wie das Ruhrgebiet, eine der hellsten Gegenden Europas. Er verfolgt die Weißen Nächte auf Usedom, wandert zu später Stunde während des Opernballs durch Wien und besteigt in der Schweiz einen Berg, um die Schwärze der Nacht kennenzulernen. Dabei trifft er Märchensammler und…
Weshalb ist die Nacht seit jeher eine Projektionsfläche unserer Ängste und Wünsche, für Märchen und Geschichten? Und warum zieht uns die Dunkelheit so magisch an? Dirk Liesemer wagt sich ein Jahr lang immer wieder in die Einsamkeit der Nacht. Er erkundet das Westhavelland, die dunkelste Region Deutschlands, ebenso wie das Ruhrgebiet, eine der hellsten Gegenden Europas. Er verfolgt die Weißen Nächte auf Usedom, wandert zu später Stunde während des Opernballs durch Wien und besteigt in der Schweiz einen Berg, um die Schwärze der Nacht kennenzulernen. Dabei trifft er Märchensammler und Astronomen, Jäger, Esoteriker und Vogelkundler – und berichtet über Lichtverschmutzung, den Tanz der Glühwürmchen und die Stille unter dem Sternenhimmel.
Über Dirk Liesemer
Aus „Streifzüge durch die Nacht“
BEVOR ICH MICH AUFMACHTE
Früher, in meiner Kindheit, wenn ich spätabends auf der Wiese vor unserem Haus stand und zum Himmel emporschaute, funkelte und blinkte es überall magisch wie zu Anbeginn der Zeit. Ich wusste, wo der Polarstern leuchtet, wo Orion und Kassiopeia zu finden sind, welche Mondphase als nächste kommen würde und dass sich alles über einem dreht, wenn man nur lange genug das Firmament betrachtet. Der Blick ins dunkle Universum weckte meine Fantasie. Alles war so weit, so schwarz, so offen. Ich liebte die Stille und die Weite des funkelnden [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Bevor ich mich aufmachte
Winternächte
Hinaus in die Abenddämmerung
Wintersonnenwende
Entlang der Isar
Vollmond und Tiefschnee im Karwendel
Farbspiele über dem Englischen Garten
Auf dem Stephansplatz
Kottenheider Geschichten
Kosmische Nebel über Bärenstein
Zurück zur Nacht!
Frühlingsnächte
Im Waldecker Wald
Im Reich der Glühwürmchen
Hamburger Geräusche
Eine lange Nacht auf Rügen
Im Schlossgarten von Putbus
Von Swinemünde nach Greifswald
Crex Crex, Sirrr, Sirrr
Sommernächte
Sommersonnenwende
Ein Iridiumflash
Eine Nacht auf dem Velmerstot
Unter Wildschweinen
Stille im südlichen Ruhrgebiet
Leuchtende Wolken
Der Murmelstrom von Zürich
Hinauf zum Bockistock
Die Farben von Leipzig
In den Dünen Amrums und im Watt
Herbstnächte
Ein Mondaufgang im Havelland
Licht, das sich in Wolken spiegelt
Finsternis am Großen Stechlin
Unterwegs zur Zitronengelben Tramete
München in groben Strichen
Am Ende der Nacht
Was bleibt
Mein Dank gilt …







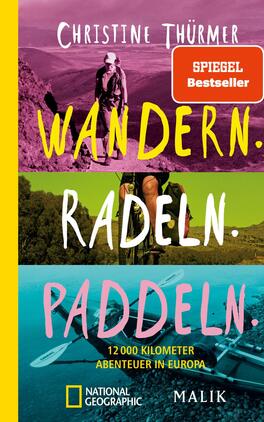



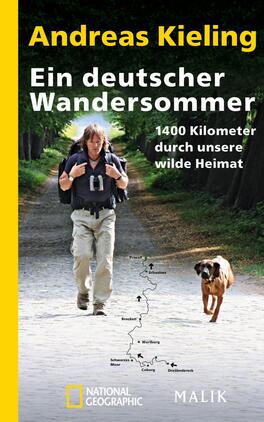
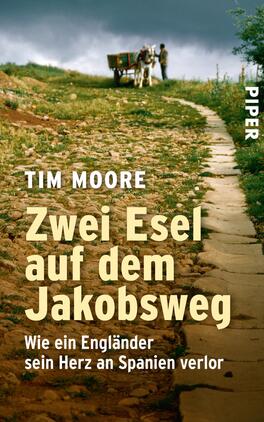






Die erste Bewertung schreiben