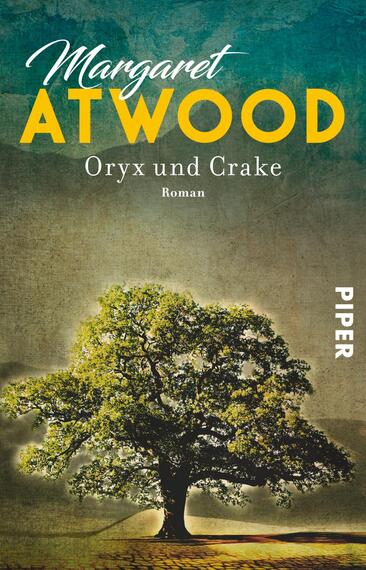
Oryx und Crake
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Crake und Jimmy sind Freunde, und sie lieben dieselbe Frau: die rätselhafte Oryx. Sie leben in einer von Klimakatastrophen bedrohten Welt in einer gar nicht so fernen Zukunft. Crake, ein Genie genetischer Manipulation, ist Wissenschaftler und arbeitet an der Entwicklung neuer Medikamente, die die Menschen gegen Epidemien immunisieren sollen, aber er verfolgt darüber hinaus seine ganz eigenen Pläne ...
Margaret Atwood entwirft in „Oryx und Crake“ eine dystopische Welt, eine Welt der Umweltkatastrophen und des Klimawandels, der Sturmfluten und Epidemien, in der sich die wenigen Reichen in streng…
Crake und Jimmy sind Freunde, und sie lieben dieselbe Frau: die rätselhafte Oryx. Sie leben in einer von Klimakatastrophen bedrohten Welt in einer gar nicht so fernen Zukunft. Crake, ein Genie genetischer Manipulation, ist Wissenschaftler und arbeitet an der Entwicklung neuer Medikamente, die die Menschen gegen Epidemien immunisieren sollen, aber er verfolgt darüber hinaus seine ganz eigenen Pläne ...
Margaret Atwood entwirft in „Oryx und Crake“ eine dystopische Welt, eine Welt der Umweltkatastrophen und des Klimawandels, der Sturmfluten und Epidemien, in der sich die wenigen Reichen in streng gesicherten Wohnkomplexen von den verarmten Massen abschotten.
„Ein atemberaubender Science-Fiction-Thriller und ein beißender Kommentar auf den Zustand unserer Welt.“ NDR
Über Margaret Atwood
Aus „Oryx und Crake“
Schneemensch erwacht vor Tagesanbruch. Reglos liegt er da und lauscht der kommenden Flut, die Welle um Welle über die verschiedenen Barrikaden hinwegschwappt, hin – her, hin – her, der Rhythmus des Herzschlags. Er würde so gerne glauben, dass er noch schläft.
Am östlichen Horizont liegt ein grauer Dunstschleier, der jetzt in einem blassroten, tödlichen Licht erglüht. Seltsam, wie zart diese Farbe noch wirkt. Davor stehen als schwarze Silhouetten die Türme im Meer und ragen absurd aus dem Rosa und Blassblau der Lagune auf. Die Schreie der Vögel, die dort draußen [...]





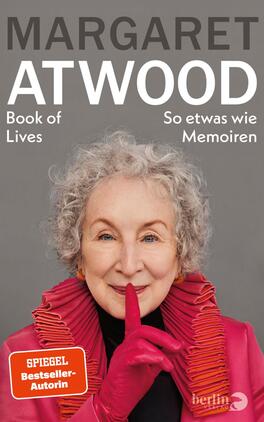
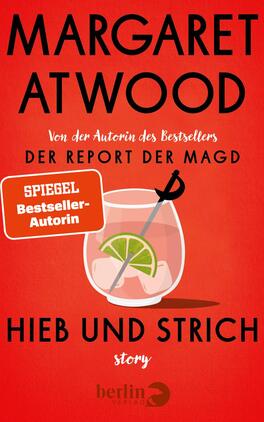


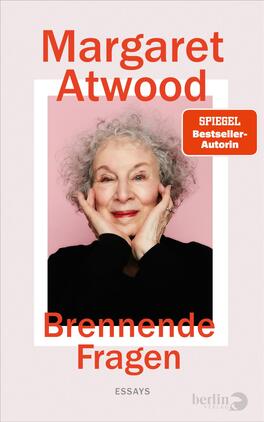
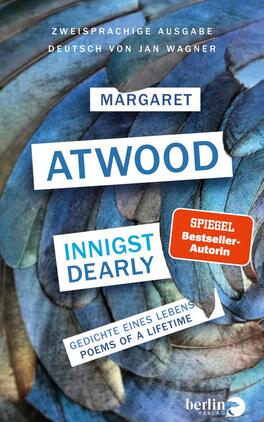
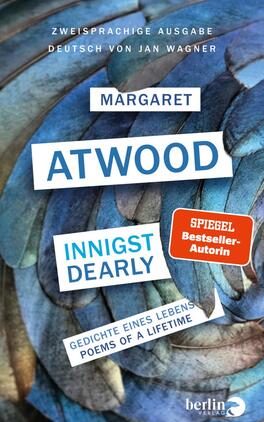

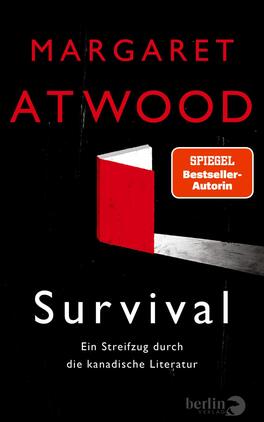
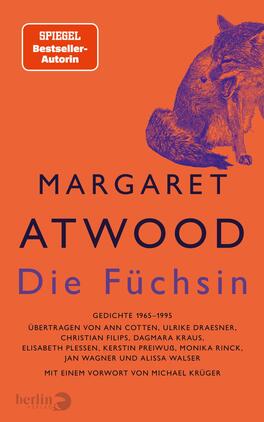
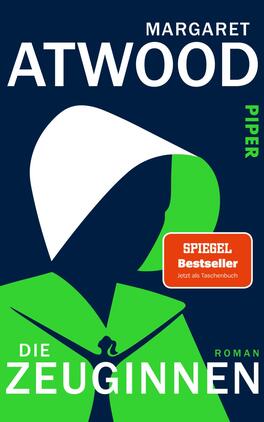



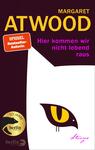
Die erste Bewertung schreiben